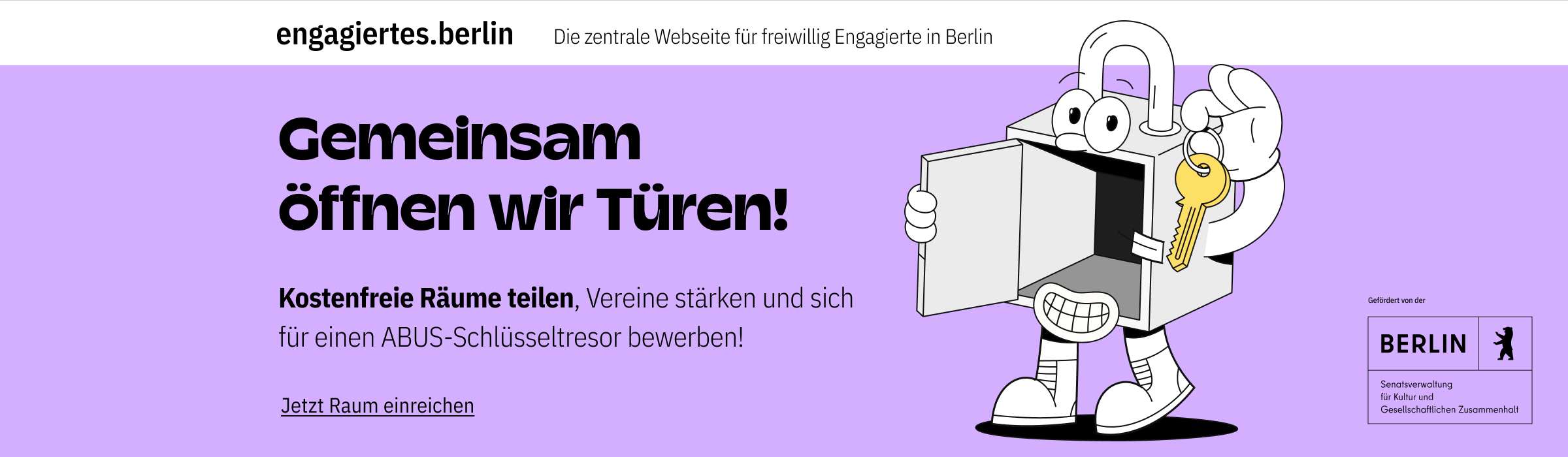Mit Selam Berlin (2003) veröffentlichte die 1965 in Çayırlı geborene und im ehemaligen West-Berlin aufgewachsene Yadé Kara ihren mehrfach ausgezeichneten Debütroman. Mit Leichtigkeit wirft er verstaubt-orientalistische Klischees des ewigen Dualismus von Morgen- und Abendland in der ach-so-zwiegespaltenen Türk*innenbrust über Bord.
„Kanacke her, Almancı hin. Egal, ich war, wie ich war. Ich war ein Kreuzberger, der sich voller Neugier und Saft im Sack auf das Leben stürzte.“ (5)
So bestechend einfach begründet der neunzehnjährige Hasan Selim Khan Hazan, von seinen westdeutschen Freunden auch „Hansi“ genannt, die Entscheidung, unmittelbar nach dem Fall der Mauer im November 1989 aus Istanbul zurück in seine Geburtsstadt Berlin zu ziehen. Sein Leben zuvor lässt sich als eines „in transit“ beschreiben: Die Eltern von Hasan und Ediz, seinem Bruder, entschieden seinerzeit, dass diese als Jugendliche besser in der Türkei aufgehoben wären. Es folgten eine Long-Distance-Ehe und beständiges Pendeln zwischen Istanbuler Alltag bei der Mutter und mit deutscher Schule und vereinten Sommerferien in Berlin, wo die Söhne ihrem Vater im Reisebüro aushalfen. Dann, zu Romanbeginn, fällt die Mauer, und nichts bleibt, wie es war.

„Seit die Mauer gefallen war, ging alles anders“
In Selam Berlin imaginiert Kara eine Perspektive auf den Mauerfall, die im Südosten Kreuzbergs verankert ist. Das Kreuzberg also, das zu Zeiten der Teilung Deutschlands auf drei Seiten von einer Mauer umgeben war. Historische Beiträge dazu gibt es inzwischen einige, wie auch dieser bei uns erschienene Artikel (https://renk-magazin.de/kreuzberg-schwarz-weiss-die-bunten-70er/). Was Karas Roman besonders macht, ist, dass in seinem Zentrum ein Mensch steht, der in der Mehrheit der fiktionalen Geschichten zum Mauerfall kaum zu Wort kommt.
„Plötzlich standen Straßen, Plätze, Orte meiner Kindheit im Interesse des Weltgeschehens. Autos hupten, Leute brüllten, grölten, jubelten und feierten bis spät in die Nacht. Sie tanzten, lachten und sangen auf ein neues Berlin.“ (8)
So lesen wir von Hasans Leben zwischen Adalbert- und Waldemarstraße. Von den Konflikten zwischen seinem preußisch-marxistischen Vater und der elitären Istanbuler Mutter, die so gar nichts mit türkischen Gastarbeiter*innen in Deutschland zu tun haben möchte. Von Punks, Alt-Berliner Rentnerpaaren, „Ossitürken“, Hippies, stationierten US-amerikanischen Soldaten oder auch Filmemacher*innen, die sich etwas auf ihre möchtegern-innovative Entdeckung des „Türken“ als street-kredibiles Sujet für Großstadtfilme im Drogenmilieu einbilden. Vom Lieben, Begehren und Leiden über kulturelle Unterschiede und nationale Grenzen hinweg. Von alten und neuen Familien.
Hasans Berlin ist bunt, vielfältig, voller Gegensätze und Ambivalenzen, und nichts und niemand davon bleibt vom Mauerfall unberührt. Erst recht nicht Hasans Familie, als die Wiedervereinigung ein lang gehütetes Geheimnis lüftet, das ihr Leben auf den Kopf stellt.
Zeitreise in die 80er-Jahre
Selam Berlin zu lesen, gleicht einer fiktionalen Zeitreise in das Berlin der späten 80er-Jahre. Im Radio laufen Prince und Ofra Haza, Spike Lees Do the Right Thing feiert Premiere im Kino, man trägt Levi’s 501 und Doc Martens, und alle zieht es zum Feiern nach Schöneberg. Bevor sich jedoch ein verklärtes Gefühl von Nostalgie und Sehnsucht nach der „guten alten Zeit“ breit machen kann, scheut der Text nicht davor zurück, zu thematisieren, was auch Teil der Lebenswirklichkeit von Menschen mit Migrationsgeschichte war: die Bedrohung durch rechtsextreme Gewalt. Hasans Cousine, Leyla, entgeht nur knapp einem Angriff in der U-Bahn, bei dem ihre Haare in Brand gesetzt werden. Sein bester Freund, Kazim, wird brutal zusammengeschlagen und landet schwer verletzt auf der Intensivstation.
„Berlin, Mauer, Ost, West gingen an Mama vorbei. Obwohl sie direkt an der Mauer wohnte. Sie sagte: ‚Wölfe aus dem gleichen Rudel beißen sich nicht, aber sie töten Wölfe aus anderen Rudeln.‘ Das war das einzige, was sie zum Mauerfall sagte. Jahre später dachte ich oft an diesen Satz. Als in Hoyerswerda, Solingen und Mölln die Flammen hochgingen und ganze Familien verkohlten.“ (120)
In diesem kurzen Austausch zwischen Mutter und Sohn zeichnen sich schließlich auch die Umrisse der Serie rechtsradikaler Ausschreitungen und Angriffe der frühen 90er-Jahre ab, die in den tragischen Brandanschlägen von Mölln am 23. November 1992 und von Solingen am 29. Mai 1993 gipfelten, bei denen insgesamt acht türkischstämmige Menschen um ihr Leben kamen.
Ein Jahr im Leben von …
Selam Berlin handelt von einem Jahr im Leben von Hasan Hazan, beginnend am Tag des Mauerfalls am 9. November 1989 und endend am Tag der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990. Leichtfüßig zieht Hasan mich oft mit in sein wiedervereintes Berlin, in das er voller Hoffnungen und jugendlichem Tatendrang zurückkehrt und dabei ganz nebenbei über deutsch-deutsche, deutsch-türkische und türkisch-türkische Verhältnisse reflektiert.
„Die Leute in Istanbul waren anders drauf, da hatte Ediz recht. Sie hatten Autos, Videos und L’Oréal blonde Frauen. Sie feierten Parties und liefen in Bikinis am Strand herum, und am Abend schauten sie sich Dallas an. Sie berechneten ständig Preise, Inflation und Mieten, dabei sparten sie sich die letzte Lira von Munde, um ihre Kinder in Englisch- und Computerkurse zu schicken. Sie waren dynamisch und strebten nach Westen. In Kreuzberg dagegen hielten die Leute an Werten wie Ehre, Familie und Traditionen fest. Einige von ihnen schickten ihre Kinder in Koranschulen. In Istanbul war das längst passé.
Die Leute lebten mitten in Kreuzberg, Berlin, Europa, aber sie schauten nach Osten, nach Mekka. Hier waren sie türkischer als die Türken in Istanbul. Und dort verschwieg Ediz oft, daß er in Berlin geboren war. Für die Reichen von Istanbul war Deutschland gleich Gastarbeit-Dreckarbeit. Sie blickten nach Florida, Boston und New York.“ (157)
Hasans Denken, Fühlen und Handeln bestimmt das Geschehen, jedoch nicht immer auf unproblematische Weise. Heteronormativ, sexistisch, mit einem Frauen zu reinen Lustobjekten degradierenden Blick kommt er stellenweise auch daher. Toxisch in seiner Vorstellung der Geschlechterverhältnisse, als er seine lose Liebschaft, Cora, dafür ohrfeigt, dass sie ihre Sexualität selbstbestimmt auslebt. So sehr die Figur Hasan auch von Ausschlüssen und Gewalterfahrungen betroffen ist, sie ist nicht frei davon, diese zu reproduzieren. In dieser komplexen und widersprüchlichen Repräsentation einer Form marginalisierter Männlichkeit, die einfachen Zuschreibungen entgegen läuft, ist der Roman letztlich wieder authentisch.
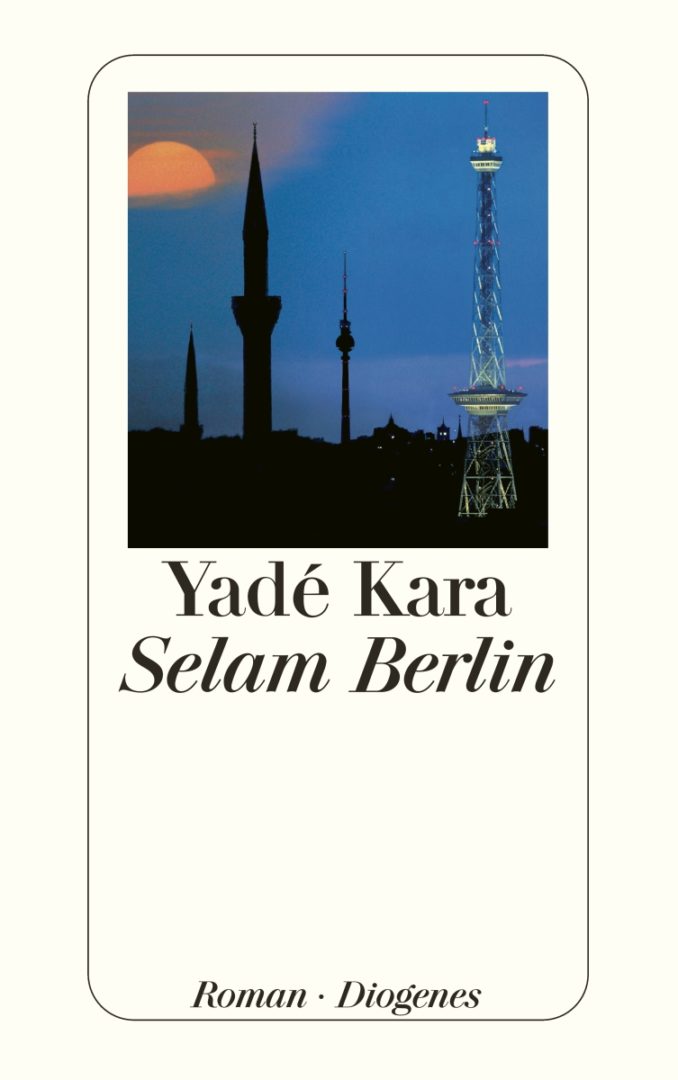
„Ich war wie ein Flummiball, sprang zwischen Osten und Westen hin und her, ha.“
So springe ich mit Hasan durch das Berlin, kreuz und quer, mit all seinen Wünschen und Sehnsüchten – nach einem Studienplatz, einer intakten Familie, einer Beziehung, einer Wohnung, einem Job, einer Karriere im Film. Eine Suche ist es dabei ganz besonders, mit der mich der Roman schließlich packt.
„Wir suchten immer nach etwas Türkischem in Zeitungen, im Fernsehen, in Schulbüchern. Damals im Deutschland der siebziger Jahre. Ich suchte nach so etwas wie meinen türkischen Schatten. Überall, wohin ich schaute, war er sichtbar. In den breiten Hüften von Sophia Loren, in arabischer Musik, im Fladenbrot beim Bäcker, im Schnurrbart von Omar Sharif. Ich fand Anthony Quinn türkisch, obwohl er Mexikaner war. Baba und er hatten den gleichen Teint, die blitzenden Zähne. Ich suchte immer nach etwas, was uns ähnlich war. Sonst lief damals nichts Türkisches im Deutschen Fernsehen. Die Leute vom Fernsehen hatten uns einfach vergessen.“ (282)
Die Suche, die mich am meisten berührt, ist Hasans Suche nach Anerkennung und Wertschätzung. Danach, sichtbar zu sein, eine Stimme zu haben und gehört zu werden. Nach Repräsentation von diversen Perspektiven und Erfahrungen. Diese Suche, finde ich, ist 2019 nach wie vor so relevant wie 2003 und 1989. Für uns alle.
Yadé Kara. Selam Berlin. Zürich: Diogenes Verlag AG Zürich. 2004. (Zuerst erschienen 2003)
Text: Ahu Tanrısever
Titelbild: Ergun Çağatay Portrait: Michael Mayer/ Buchcover: Diogenes Verlag