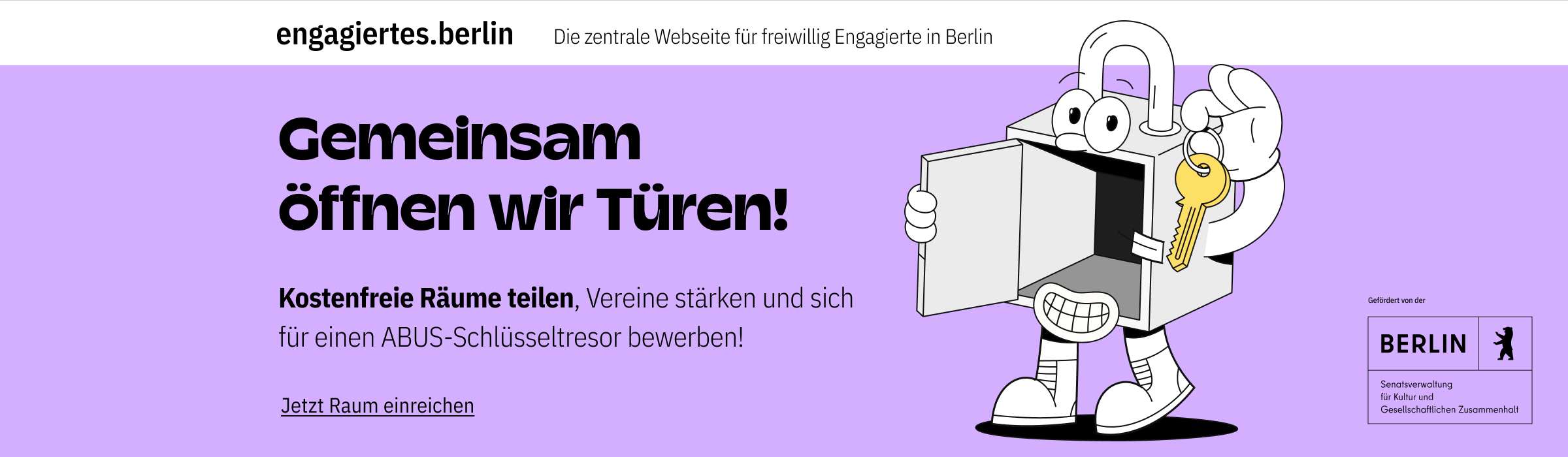Sie sind enttäuscht, werden bedroht und verlassen ihre Heimat. Hier erzählt der Schriftsteller Barbaros Altuğ über die Türken im Exil – von L.A. bis Zagreb.
Weggehen
Bei den Gezi-Protesten in Istanbul 2013 habe ich täglich demonstriert, da hatte ich das letzte Mal Hoffnung für mein Land. Nachdem sie vorbei waren, sah ich eigentlich schon ein: Das wird nichts mehr. Ende 2013 kam ich nach Berlin. In der Torstraße begann ich, an einem Buch zu schreiben. Meine damals entstandene Novelle heißt „Es geht uns hier gut“ und handelt von drei jungen Menschen, die in der Folge von Gezi aus der Türkei nach Berlin ziehen – mittlerweile ist sie auch auf Deutsch erschienen.
Danach bin ich noch einmal zurück nach Istanbul. Es ist doch meine Heimatstadt.
Ich bin 1972 geboren, habe in Ankara Ingenieurwesen studiert. Irgendwann begann ich, als Journalist zu arbeiten, schrieb für Magazine wie die türkische „Elle“. Bei der inzwischen geschlossenen Tageszeitung „Taraf“ war ich zwei Jahre lang Kolumnist, habe alles Antidemokratische kritisiert. Der Chefredakteur Ahmet Altan, der mich einst angeworben hatte, wurde kürzlich zu lebenslanger Haft verurteilt. Für mich ist er ein Held.
Im Jahr 2000 habe ich die erste Literaturagentur in Istanbul gegründet. Ich fand, dass türkische Schriftsteller auf dem weltweiten Markt unterrepräsentiert sind. Damit war ich erfolgreich, mehr als 40 Autoren vertrete ich noch heute. In Istanbul bin ich eine bekannte Figur. Ich setzte mich immer stark für die Rechte von Homosexuellen ein. Meine Freunde – Schriftsteller, Schauspieler und andere Künstler – und ich lebten wie eine kleine Familie im Stadtteil Cihangir.

Die AKP von Erdogan kam 2002 an die Macht. Während der ersten Jahre war ich noch hoffnungsvoll, die Partei war beispielsweise der EU gegenüber aufgeschlossen.
Der endgültige Bruch mit meinem Land kam mit dem Putschversuch. In jener Julinacht 2016 war ich zu Hause in Cihangir. Mein damaliger Partner und ich sollten am nächsten Tag nach Los Angeles fliegen, wegen einer Filmproduktion. Ein Freund schickte mir plötzlich eine Nachricht: „Etwas passiert hier.“ Ich dachte an nichts Böses. Dann habe ich den Fernseher angeschaltet: Panik, Menschen redeten unverständlich durcheinander. Über mein Cihangir flogen Armeeflugzeuge, meine Freunde aus der Nachbarschaft riefen mich an, ihre Fenster waren von dem Druck zersprungen. Ich muss noch heute weinen, wenn ich daran denke, wie ich meinen damaligen Partner telefonisch zu erreichen versuchte. Irgendwann ging ich hinunter in mein Ankleidezimmer und blieb dort regungslos bis zum nächsten Morgen.
Den Tag darauf flogen mein Freund und ich sofort nach L.A. und dann direkt nach Paris, wo er sich ohnehin für ein Studium beworben hatte. Ich fand eine kleine Wohnung für uns. Wir wussten: Wir können nicht mehr zurück.
Ankommen
So wie mir ging es vielen.
Die meisten Intellektuellen, Schriftsteller und Journalisten leben im Exil, wenn sie nicht gerade im Gefängnis sind. Ich kenne einen Kulturprofessor, der um die 70 ist und die Türkei gerade verlassen hat. In dem Alter, stellen Sie sich das vor!
Ich selbst konnte einfach nicht in einem Land bleiben, in dem ich nicht frei denken oder handeln darf. Ich bin schwul. Ich bin ein Autor. Ich war Journalist. Ich kann nicht heterosexuell werden. Ich kann nicht vom Denken ins Nicht-Denken wechseln.
Außerdem wäre ich in der Türkei vielleicht verhaftet worden, gegen mich liegt ja jetzt schon eine Anklage wegen Beleidigung vor, da ich die Regierung auf Twitter „scheinheilig“ genannt habe. Das Verfahren läuft, es könnte sein, dass ich bald mehrere Tausend Euro Strafe zahlen muss. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Jeden Tag bekomme ich auf Facebook Drohnachrichten wie „Wir werden dich umbringen“. Die Faschisten wollen uns Intellektuelle und Künstler nicht mehr haben. Sie denken, das sei jetzt ihr Land, weil sie in der Überzahl sind.
Wir alle haben das Gefühl des Zusammenlebens verloren.
Meine Freunde, überhaupt Leute wie wir, leben nun in der Welt verstreut. Wir alle haben das Gefühl des Zusammenlebens verloren. Wir teilen nur die Einsamkeit, fühlen uns kollektiv allein.
Ich habe eine Freundin, eine Autorin, die nach Toronto geflüchtet ist. In der Türkei bekam sie täglich Todesdrohungen. Jetzt in Kanada geht es ihr auch nicht gut. Sie hat Depressionen, fühlt sich dort allein, kann im Alltag nicht mehr Türkisch sprechen und kennt noch niemanden.
Eine andere Freundin von mir ist gerade nach Zagreb gezogen. Sie versucht, ihre Bücher auf Englisch zu schreiben. In einer fremden Sprache zu arbeiten, ist aber das Schwierigste für einen Autor. Die Heimat, jedes Geräusch, jeder Geruch und die Umgebung fließen ins Schreiben ein.
In Paris ist es unmöglich, ein türkisches Umfeld aufzubauen, dort leben schlicht nicht so viele Türken. Ich habe nur zwei türkische Freunde, die Pariser behandeln mich, als wäre ich ein Strauß im Zoo. Das ist fast überall so – ich meine, wie viele Türken leben in Zagreb, zwei vielleicht? Das Türkische in einem wird alt, die Sprache, das Land und die Leute verändern sich, während man nicht dabei ist. Man kann eben keine aktuelle Berlin-Novelle schreiben, wenn man Berlin vor Jahren verlassen hat.
Bleiben
Wir Exilanten haben zwar keinen türkischen Kreis in unserem reellen Umfeld, aber wir schaffen ihn auf andere Weise: Indem wir uns E-Mails schreiben, uns manchmal irgendwo auf der Welt treffen. Kürzlich bekam ich eine lange und ausgesprochen persönliche Nachricht von einem Türken, der nach Australien gegangen ist. Den kannte ich vorher gar nicht.

Demnächst treffe ich all meine alten Freunde in Paris. Wir werden abends essen gehen und uns unterhalten. Zum Beispiel über Deniz Yücel, der nach einem Jahr Haft ohne Anklage endlich freigelassen wurde. Das freut mich für ihn und seine Familie, zeigt aber natürlich noch lange nicht, dass Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei gesichert sind oder dass das Rechtssystem funktioniert.
Bis vor Kurzem haben wir auch viel über die AKP gesprochen. Dann stellten wir fest, dass die Regierung sogar schon unsere Zeit in Anspruch nimmt, wenn wir nicht im Land sind! Also entschlossen wir uns, nicht mehr darüber zu reden. Im Exil werden wir schließlich nicht von der AKP regiert – nun auch nicht mehr innerlich.
Jetzt reden wir über Filme und Bücher. Darüber, was wir tun und tun wollen, über das Leben und immer wieder über unsere Einsamkeit. Dabei kann es spät werden. Wenn einer zu betrunken ist, kann er einfach bei jemand anderem im Hotelzimmer bleiben.
Träumen
Ich bin immer viel gereist und war doch jedes Mal froh, nach Istanbul heimzukehren. Selbst jetzt komme ich ab und an zurück – auch wenn ich fürchte, festgenommen zu werden. Das letzte Mal war ich vor ein paar Monaten in der Stadt. Sie wirkte gespenstisch. Das Atatürk-Kulturzentrum, seit jeher ein wichtiger Ort für mich, wurde gerade abgerissen. Als Kind ging ich dort zu Ballettaufführungen, habe Fellini-Filme angesehen. Jetzt baut die Regierung genau gegenüber eine riesige Moschee. Symbol dafür, was die AKP will: Kultur zerstören und den Islam überall dort platzieren, wo mal Kultur war.
Bald will ich nach Berlin ziehen. Ob ich die Stadt mal meine Heimat nennen werde?
Weil die Menschen in meinem Leben die Türkei verlassen haben, fühlt sich das Land leer an, was natürlich Unsinn ist, dort leben ja 80 Millionen Leute.
Mein Land hat eine Tradition der Putschversuche und Migrationswellen, aber die jetzige Exilwelle ist besonders. Meist kehren Exilanten innerhalb von drei Jahren zurück, das wird dieses Mal nicht so sein, fast niemand von uns will zurückgehen. Eigentlich möchte ich das nicht sagen, die jungen Türken sollen schließlich Hoffnung haben, aber: Die Türkei ist ein verlorener Fall. Das Land tut mir leid.
Bald will ich nach Berlin ziehen. Ob ich die Stadt mal meine Heimat nennen werde? Nein. Ist Istanbul mein Zuhause? Nicht mehr. Ich habe ein totes Zuhause. Eine kaputte Liebesgeschichte, von der ich nur noch träume.
Protokolliert von Yasmin Polat. Dieser Artikel erschien ursprünglich im Sonntags-Magazin von Der Tagesspiegel.
Fotos: Dilan Boyzel