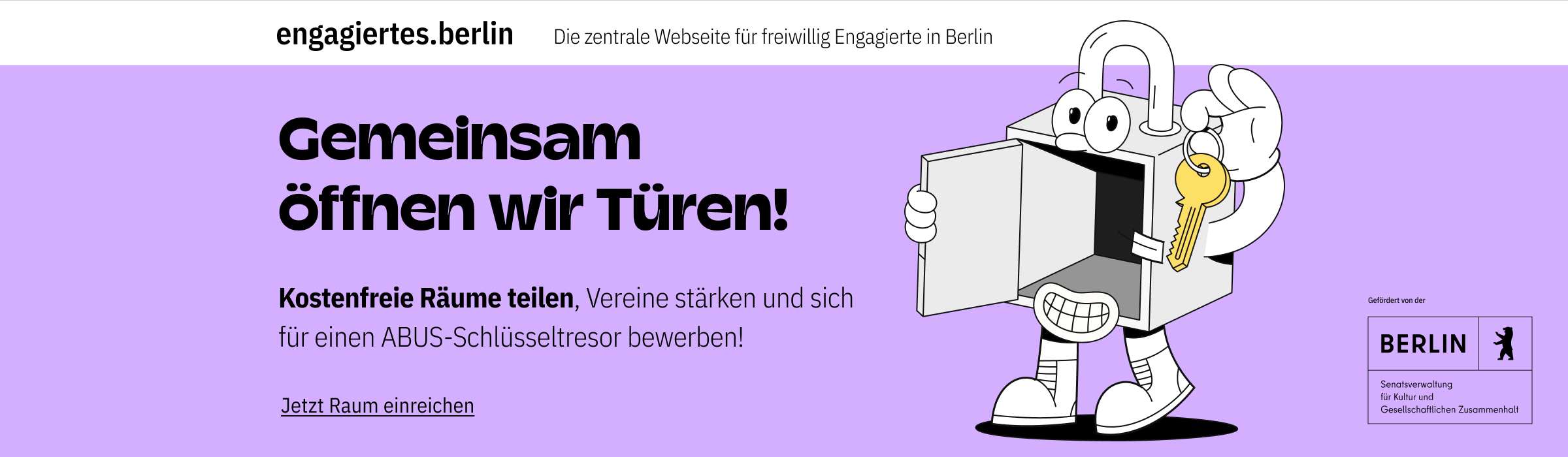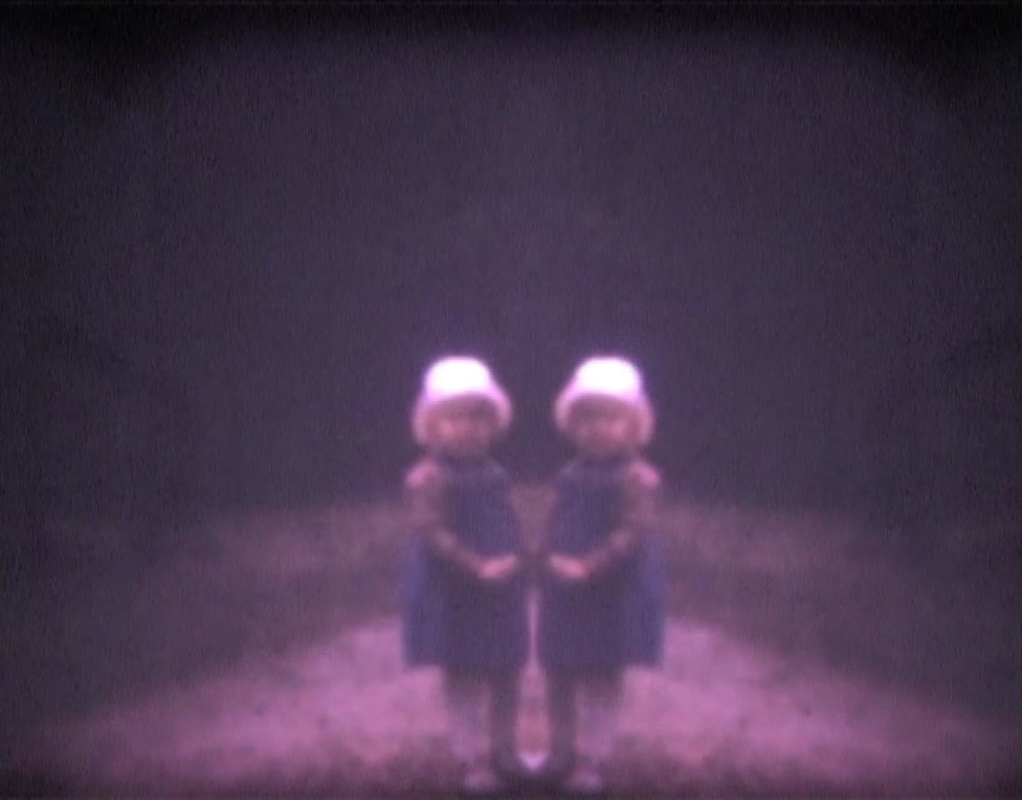Das Wort Chancengleichheit begegnet uns immer wieder. Und oft merken wir: Es ist tatsächlich nur das: ein Wort, nicht mehr und nicht weniger. Konsequenzen, die tatsächlich für Gleichberechtigung und ausgewogene Chancen sorgen könnten, fehlen zumeist. Das merken schon Berliner Schüler*innen. Ihnen begegnet, noch vor dem Abschluss und auf dem Weg auf den Arbeitsmarkt der Hauptstadt, dieses machtvolle Werkzeug: die Sprache.

Sprache im Unterricht: Deutsch ist nicht „besser“
Für alle Schulformen quer durch Berlin gilt: Die Sprache spielt im Unterricht eine bedeutende Rolle, wenn Inhalte vermittelt werden sollen. Zweifellos ist es hier wichtig, dass Schüler*innen dazu in der Lage sind, dem Unterricht auf Deutsch zu folgen und sich zu beteiligen.
Keinesfalls aber ist es so, dass die deutsche Sprache als wichtiger oder gar bedeutsamer präsentiert werden sollte. Geschieht dies, entsteht ein Machtgefälle und die Muttersprache wird abgewertet. Die Normalisierung von Deutsch als Fremdsprache ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg in Richtung Chancengleichheit. Bereits jetzt gibt es etablierte Angebote für Zweitsprachler*innen, Deutsch mit Privatlehrer*innen in der Hauptstadt zu lernen.
Der Vorteil des direkten Kontakts zwischen Lehrkraft und Schüler*in ist, dass wertschätzend auf individuelle Bedürfnisse reagiert werden kann. Im Kontrast zur, in Berlin häufig spürbaren, Anonymität und dem drohenden Untergang in der Masse, kann das einen entscheidenden Unterschied machen.

Berliner Kinder mit Migrationsgeschichte: Diskriminierung und Identität
Vorurteile sind nur schwer aufzulösen. Selbst in einer so diversen und an vielen Stellen offenen Stadt wie Berlin verschwinden sie auch nach Jahrzehnten gemeinsamer Geschichte nicht. Im Gegenteil: Viele von uns kämpfen heute mit denselben Vorurteilen und Stereotypen wie bereits Generationen vor uns. Schüler*innen mit Migrationshintergrund wird nicht selten weniger zugetraut – und wenn, dann nicht nur Gutes. Im Kontakt zu Mitschüler*innen und Lehrkräften kommt es zu einer immer neuen Verstärkung des Problems.
Sprache wirkt hier als Verstärker. Auch wenn an vielen Berliner Schulen interkulturelle Offenheit suggeriert und kommuniziert wird, herrscht hinter der Fassade noch Altbekanntes. Zu erkennen ist das vor allem an der Sprache der Beteiligten. Wer allzu häufig betont, dass es Unterschiede gibt, verstärkt das Bewusstsein für Selbige. Kinder mit Migrationshintergrund werden so zwar in die Gemeinschaft aufgenommen, jedoch oft auf eine so demonstrative Weise, dass sie sich doch wieder anders fühlen.
Die Konfrontation mit Vorteilen zeigt sich dann häufig im nicht ausgesprochenen „Trotzdem“ oder „Obwohl“. „Obwohl du anders bist, akzeptieren wir dich.“ „Du siehst nicht aus wie ich, aber trotzdem bin ich gut zu dir.“ Was nach außen hin mitmenschlich und offenherzig wirkt, kann sich für betroffene Kinder alles andere als gut anfühlen. Das liegt daran, dass gerade die zur Schau gestellte Gutmütigkeit ein Machtgefälle erzeugt.
Werden Schüler*innen mit Vorurteilen konfrontiert, auch zwischen den Zeilen, dann erzeugt das bei vielen Angst. Die belastende Situation wiederum kann zu verschlechterten Leistungen, sozialer Distanzierung und Hemmungen in Bezug auf die weitere Gestaltung des Lebens führen. Ein wichtiges Learning für Entscheider*innen und Verantwortliche an Schulen ist daher:
Diskriminierung ist nicht immer aggressiv, sondern kann auch durch betonte Warmherzigkeit erfolgen.
Während Jugendliche im sozialen Umfeld durch eigene Sprach-Modi Lösungen finden, müssen Schulen hier vor allem für ergänzende Bildung sorgen. Kiez-Deutsch kann zwar Gemeinschaft erzeugen, aber auch für Unmut sorgen. Unmut, weil sich auch privilegierte Jugendliche sprachliche Merkmale unreflektiert aneignen. In der antirassistischen Bildungsarbeit ist es daher wichtig, ein Bewusstsein für die eigenen Privilegien zu vermitteln und so einen respektvolleren Umgang zu ermöglichen.
Sprache in Berliner Schulen: Auch das System muss „entlernen“
Die Schule als traditionelle Institution steht auch in der heutigen Zeit vor großen Herausforderungen. Lange Zeit reichte es, dass Lehrende und Lernende sich klassischer Stereotype bedienten und Ausgrenzung als gegeben akzeptierten. Mit der zunehmenden Aufmerksamkeit, aber wandelt sich diese Einstellung. Nun gilt es, eine weitaus vielfältigere Gesellschaft zu erkennen und die Individualität der Schüler*innen in den Unterricht und das gesamte Geschehen zu integrieren.
Das Forschungsmagazin des Deutschen Jugendinstituts zeigt das am Beispiel der LSBT*Q Jugendlichen auf. Ihnen begegnen im schulischen Kontext, ebenso wie Migrant*innen, Vorurteile sowie Vorstellungen einer eigentlich nicht vorhandenen Norm. Dies unterstreicht die Tatsache, dass das gesamte Schulsystem alte Strukturen entlernen muss, um einer neuen Gesellschaft gerecht werden zu können.
Das Ziel dieses Prozesses muss sein, dass weder sexuelle Orientierung noch
- kulturelle Herkunft,
- sprachliche Wurzeln
- oder auch Identifikation mit Geschlechtern
ein Problem darstellen. Möglich macht dies vor allem die Sprache. Offenheit gegenüber eigener Pronomen und die Verwendung selbiger im Unterricht markiert einen Beginn. Ein differenzierter Umgang mit Schüler*innen, welche Deutsch als Fremdsprache erlernen, ebenfalls. Auch die Integration von Feiertagen mit kulturellem Bezug und ein wertschätzender Austausch innerhalb und außerhalb des Unterrichts sollte in Schulen ohne Diskriminierung selbstverständlich sein.

Der lange Weg beginnt mit Worten
Das Wort beschreibt bereits, worum es bei antirassistischer und intersektionaler Bildungsarbeit gehen sollte. Das Ziel ist nicht die weiter oben beschriebene, bewusste Betonung, sondern die Schaffung einer neuen Selbstverständlichkeit. Bis die vielgestaltige Realität vollends in den Berliner Schulen ankommt, wird es vermutlich noch einige Jahre dauern.
Sprache aber, stellt diesbezüglich einen bedeutenden und vor allem auch für jeden Menschen anwendbaren Einstieg dar. Berlin, als ohnehin multikulturell ausgerichtete Stadt, kann diesbezüglich zu einem nationalen Vorbild werden.
Titelbild: NeONBRAND | Unsplash.com