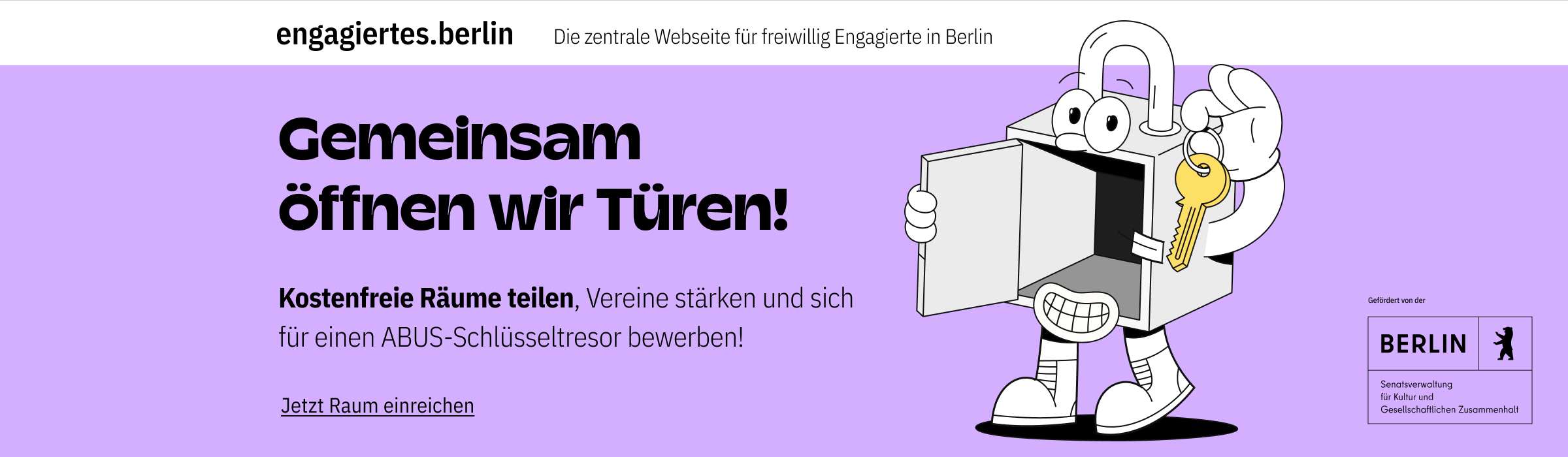Das Berliner Büro von Amnesty International ist groß, still und grau. Selmin Çalışkans Raum ist hingegen bunt und gemütlich. Seit zweieinhalb Jahren ist sie Generalsekretärin von Amnesty International. Hätte sie diese Stelle nicht angetreten, würde sie sich gerade anderswo für Menschenrechte einsetzen. In einer anderen Organisation, einem anderen Projekt oder einem anderen Land – egal. Nur wegsehen, das will und kann sie nicht. Wir setzen uns auf ihr violettes Sofa und sprechen über ihre Motivation, die Arbeit von Amnesty und ihre eigene Geschichte.
Liebe Selmin, nehmen wir mal an, ich möchte die Welt retten. Wo fange ich an?
Fang damit an, laut zu sagen, was du denkst. Das kann jeder leisten, egal ob man in einem Ingenieursbüro sitzt, im Kindergarten arbeitet oder in der Schülervertretung ist. Man braucht keine revolutionäre Bewegung, um die Welt zu retten. Jeder kann schon dort seinen Beitrag leisten, wo er sich gerade befindet. Wenn ich in der U-Bahn höre, dass eine Diskussion über Flüchtlinge im Gang ist, dann gehe ich hin und sage, wie es wirklich ist, dass Hetze unangebracht ist und dass die Daten und Fakten eigentlich eine ganz andere Lage zeigen. Damit exponiert man sich natürlich, das kann unangenehm sein. Es wäre viel leichter, sich selbst zu zensieren, um nicht anzuecken. Aber man muss dagegen halten, wenn Diskriminierendes im öffentlichen Raum geäußert wird.
Gibt es ein politisches Tabu, an das sich Amnesty International nicht heranwagt?
Wir legen unsere Finger in jede Wunde. Wir müssen zu keinem Zeitpunkt überlegen, ob wir dies oder jenes politisch äußern dürfen, da wir kein Geld von Parteien oder Regierungen annehmen. Hauptsächlich finanzieren wir uns über private Spenden. Dafür bin ich sehr dankbar. Egal, wer eine Menschenrechtsverletzung begeht, egal, wer die Opfer und die Überlebenden sind, ob das Christen, Moslems oder Buddhisten sind, Frauen, Männer oder Kinder. Jeder Mensch hat die gleichen Rechte. Dafür setze ich mich ein, ob in der U-Bahn oder auf einer ganz hohen politischen Ebene.
Woher nimmst du die Energie dafür?
Durch meine Wut. Ich bin wütend darüber, wie selbstverständlich Hassreden gegen Flüchtlinge in Deutschland sind. Ich bin wütend, wenn ich so einem Herrn Seehofer oder einem Herrn Kreuzer im Radio zuhören muss. Ich bin wirklich erstaunt, dass dem keine ganz große Empörungswelle entgegenschlägt.
Wie gehst du mit solchen Politikern um, wenn du sie persönlich triffst?
Sehr direkt. Als Herr Friedrich noch Innenminister war, hatte ich einen Antrittsbesuch bei ihm. Herr Friedrich weiß, dass ich eine Migrationsgeschichte habe und Türkin bin. Und da sagte er mir tatsächlich ins Gesicht: „Deutschland ist kein Einwanderungsland“. Ich habe geantwortet: „Doch, schon längst, übrigens auch schon auf dem Papier und Herr Friedrich, wir sind schon hier und wir bleiben hier!“
Wie hat er reagiert?
Er hat dann das Thema gewechselt. Aber für mich war das eine Frechheit. Ganz abgesehen davon, dass es politischer Schwachsinn ist. Aber wie gesagt: Ich bin da sehr geradeheraus und halte mit den Forderungen von Amnesty nicht hinterm Berg. Ich bin dafür angestellt, dass ich Missstände anprangere. NGOs sind nicht dazu da, der Regierung auf dem Schoß zu sitzen, sondern um unbequem zu sein.
Wie baut eine Organisation wie Amnesty politischen Druck auf?
Die Entstehung von Amnesty ist das beste Beispiel dafür. Amnesty ist aus einer kleinen Initiative von Peter Benenson entstanden. Er hatte mitbekommen, wie in Portugal während der Diktatur einfache Arbeiter ein Freiheitslied gesungen hatten und dafür in den Knast gewandert sind. Das hat ihn so empört, dass er daraufhin Briefe an die portugiesische Regierung schrieb. Andere schlossen sich ihm an. Und so ist Amnesty entstanden! (lacht) Amnesty International, diese große, globale Menschenrechtsorganisation, ist aus dem Impuls einer Person entstanden. Er hatte einfach eine gute Idee. Dass man nämlich durch das Scheiben von Briefen, durch Öffentlichmachung, durch Skandalisieren Menschenrechte einfordern kann. Der Druck auf der Straße entsteht dadurch, dass man sich organisiert. Und wenn man dafür keine Zeit hat, kann man immer noch Petitionen unterzeichnen. Das dauert zwei, drei Minuten.
Bewirken Petitionen denn etwas?
Ein Drittel der Petitionen von Amnesty sind erfolgreich. Dieses Drittel der Inhaftierten erhält eine Hafterleichterung oder wird sogar freigelassen. Man darf nicht unterschätzen, wie versessen diese ganzen Länder auf ihr Image auf dem internationalen Parkett sind. Ich bringe Petitionen körbeweise in Botschaften, und je größer die Körbe, desto größer ist der Druck. Auch mit unseren Aktionen treffen wir die Staaten. Wenn wir mit einer gestellten Folterszene an einer Hauptverkehrsstraße gegenüber der ägyptischen Botschaft stehen – das tut denen richtig weh.
Seit zweieinhalb Jahren arbeitest du in dieser Position bei Amnesty. Wie hat dich das verändert?
Ich habe festgestellt, dass die Arbeit auf so einer hohen Führungsposition bei mir selbst nur die harten Seiten kultiviert. Ich muss verhandeln, ich muss sehr schnell umschalten können, ich muss die ganze Zeit über tough sein. Ich kann es mir kaum leisten, meine weichen, kreativen Seiten zu zeigen und weiterzuentwickeln. Das kommt viel zu kurz in so einer Position. Auch für persönliche Entwicklung bleibt sehr wenig Zeit und Energie. Auf der anderen Seite habe ich durch das hohe weltweite Ansehen dieser Organisation und meiner Position darin mehr Gestaltungsspielraum in Bezug auf die politischen Ziele von Amnesty. Allein die öffentliche Wahrnehmung: Wenn Amnesty etwas sagt, dann hat das Gewicht. Das gibt mir die Motivation weiterzumachen, denn ich sehe: Man kann eben doch Dinge verändern.
Was ist deine Arbeit für dich?
Meine Arbeit ist ein Teil von mir. Ich bin bei Amnesty, weil ich so bin, wie ich bin. Ich bin wütend, wenn ich von Menschenrechtsverletzungen lese. Ich bin sehr empathisch, auch weil ich viel mit Menschen zu tun hatte, deren Menschenrechte verletzt wurden. Ich habe in bewaffneten Konflikten gearbeitet, war unterwegs in Kriegsgebieten, habe selbst in aussichtslosen Situationen versucht, Kampagnen und Lobbyaktionen durchzuführen. Es tut mir weh, wenn es anderen wehtut.
Hast du auch heute noch direkten Kontakt zu Betroffenen?
Ja, und ich suche ihn auch. Ich kann nicht nur hier im privilegierten Deutschland sitzen und mal nach Brüssel, mal nach New York fliegen. Ich muss ins Feld gehen und nahe bei den Betroffenen sein. Im März waren wir in Kamerun, um dort ein Zeichen zu setzen für die Rechte Homo- und Transsexueller. Menschen, die dort jeden Tag auf der Straße bespuckt und verfolgt werden. Ich war auch in Mali, wo General Sanogo nach seiner Machtübernahme systematisch Soldaten foltern und töten ließ. Sie waren verschwunden und wurden später in Massengräbern gefunden. Eine Woche lang waren wir mit den Angehörigen zusammen, mit den Eltern, den Kindern, den Witwen. Es ist so wichtig, dass diese Menschen gehört werden. Die Welt muss erfahren, was ihnen widerfahren ist. Amnesty International spricht nicht nur mit Betroffenen, sondern verleiht ihnen eine Stimme und fordert mit ihnen gemeinsam ihre Rechte ein.
Wie hast du den Weg zu dieser Arbeit gefunden?
Über meine eigene Migrationsbiografie. Ich wurde 1967 in Düren geboren. In der ersten Zeit waren wir als Gastarbeiterfamilie sehr willkommen. Als ich dann so 10, 12 Jahre alt war, kam der Anwerbestopp und die Stimmung in Deutschland kippte schnell. Meine Eltern hatten bis dahin immer deutsche Freunde und Kollegen, dann aber plötzlich nicht mehr. Ich habe uns als sehr fremd empfunden, wenn wir über die Straße gegangen sind. Ich dachte immer, dass wir eigentlich gar nicht hierher gehören.
Und wie kamst du schließlich zur Menschenrechtsarbeit?
Ich habe in einer evangelischen Gemeinde türkischen Kindern bei den Hausaufgaben geholfen. Und dann war ich sehr schnell bei irgendwelchen Projekten dabei. Zugleich bin ich zur Antifa in Düren gegangen. In den 90ern habe ich dann meinen damaligen Mann kennengelernt und wir sind mit unserem Kind nach Bonn gezogen. Dort haben wir uns auch in der Antifa engagiert. Und was haben wir ganz oft gemacht? Wir haben Flüchtlingsheime bewacht! Und dann schaue ich mir die aktuelle Lage an und denke, das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen jetzt schon wieder Flüchtlingsheime bewachen. Weil es sonst niemand tut! Obwohl die Aufnahmebereitschaft in Deutschland viel höher ist als damals. Das sollten die Medien mal betonen und nicht immer nur denen Raum geben, die gegen Flüchtlinge und Migranten hetzen. Die Leute, die sich ehrenamtlich für Flüchtlinge einsetzen, das sind die wahren Helden.
Wie ist es eigentlich, eine Arbeit zu haben, die den Alltag vollständig durchdringt? Du kannst ja keine Zeitung lesen, ohne an deine Arbeit erinnert zu werden.
Oh ja, das stimmt (lacht). Um abschalten zu können, treffe ich mich mit Freundinnen zum Plaudern, und zwar nicht über Amnesty. Und wo es sich ergibt schwinge ich mein Tanzbein, ich liebe Salsa und Tango! Außerdem schaue ich sehr gerne türkische Telenovelas. Aber gute! Hier im Amnesty Büro spricht niemand türkisch, und in Berlin fehlt mir die Zeit, Kontakte zur türkischen Community aufzubauen. Und wenn ich dann so eine Telenovela, eine dizi, schaue, ist das ein bisschen wie ein Zuhause für mich. Die Art des Humors, worüber gelacht wird, wie was gesagt wird, die Sprache, die Redewendungen. Das ist wie eine schöne kuschelige Decke, in die ich mich einhüllen kann. Türkisch zu sprechen fehlt mir.
Viele Menschen wissen genau, was in der Welt geschieht und entscheiden sich, wegzusehen. Ist es ein legitimer Wunsch zu sagen „Ich lebe hier in einem friedlichen Land, hier ist alles so, wie es sein sollte, das möchte ich genießen können.“
Ich möchte das natürlich auch genießen können. Aber ich möchte, dass alle Menschen das genießen können und nicht nur die, die im privilegierten Deutschland leben. Ich verstehe nicht, warum jemand keine Petitionen unterschreibt und nicht versucht, etwas zu verändern. Jeder, der privilegiert ist, ist dazu verpflichtet.
Credits
Text: Dorothea Drobbe
Fotos: Michael Kuchinke-Hofer