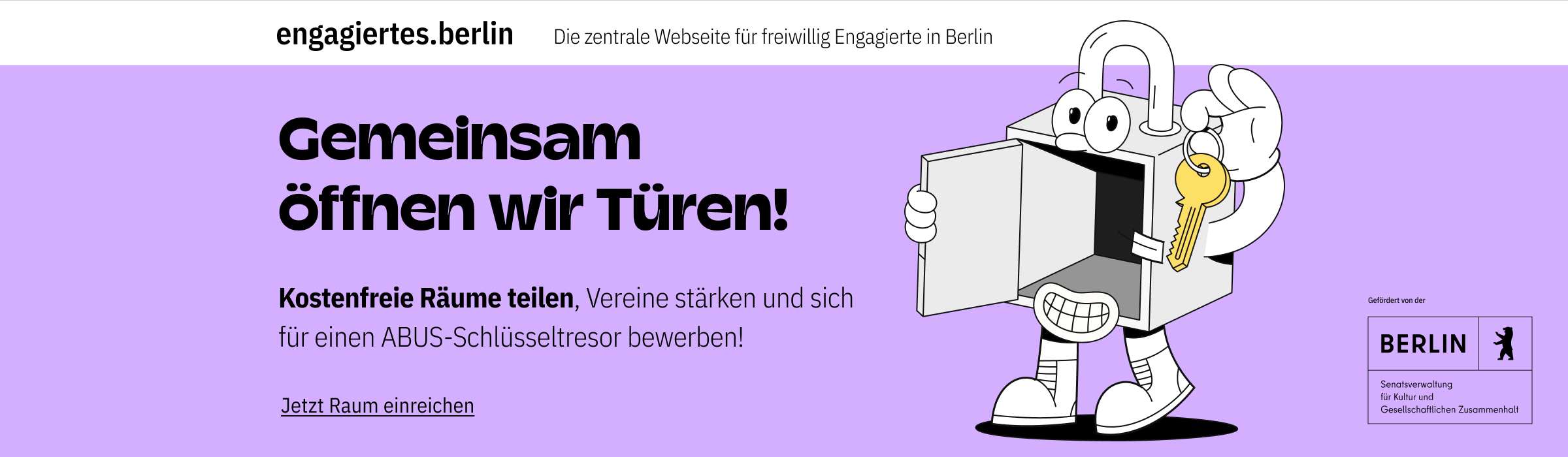„Ein Mann bleibt stehen und sieht dich an.
Sieht die Fremde in deinem Gesicht. Du siehst ihn an.
In euren beiden Gesichtern ist eine Fremde,
ein seltsamer Kummer, der wie ein säuerlicher Geschmack
euer ganzes Leben durchzieht.
Deine Fremde ist seine Fremde,
seine Fremde bist du.“
Was ist los in der Naunynstraße? (Fragment) Aus: Deutschland ein türkisches Märchen. Gedichte Übersetzt von Gisela Kraft, Claasen Verlag 1978.
Ich habe das erste Mal von Aras Ören gehört, als ich für eine Hausarbeit recherchierte: Über Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in Deutschland und die Frage, wie sie in den 60ern und 70ern zu ihrer Integration beigetragen oder nicht beigetragen haben. Ören wird als einer der ersten Dichter migrantischer Literatur in Deutschland bezeichnet. Sein Poem Was will Niyazi in der Naunynstraße? (1973) ist das erste Werk der „Gastarbeiterliteratur“, das von der breiten Literaturszene in Deutschland wahrgenommen wurde. Ören schrieb immer in türkischer Sprache, doch seine ersten Texte in der Emigration wurden zuerst nur in deutscher Übersetzung publiziert.

Fremd, unverstanden aber hoffnungsvoll
Ich sitze in der Fasanenstraße, der berühmten Allee, die den Kudamm schneidet, in der sich das Käthe-Kollwitz-Museum befindet und in der Aras Ören mittlerweile wohnt. Ein Autor, einer dessen Name für eine ganze Literaturrubrik steht und von dem trotzdem kein einziger meiner Bekannten je gehört hat.
Ich habe zwei Bücher von ihm dabei, die Naunynstraße sowie die Textsammlung „Wir neuen Europäer“. Ich blättere sie noch einmal durch, bevor ich klingeln werde. Mir begegnen Figuren, die nur dadurch verbunden sind, zur gleichen Zeit am gleichen Ort zu wohnen: Im Kreuzberg der 70er Jahre. Da gibt es einen türkischen Mann, der nach Deutschland kam, um wie die Reichen aus dem Istanbuler Edelviertel Bebek zu leben. Eine alte Deutsche, arm, verbittert, die auf ihr Leben zurück blickt und vom Hotel Adlon träumt. Eine Türkin, deren Sohn beim Putsch 1960 erschossen wurde, und die aus Trotz und Stolz nun in Deutschland den Sozialismus fordert.
Ich habe beide Bücher in einem Schlag durchgelesen. Sie haben mich gepackt. Niedergeschmettert, vielleicht eher. Ich habe angefangen, mich zusammen mit den Figuren fremd zu fühlen, klein, trotzig, unverstanden und unverständlich, enttäuscht, aber auch hoffnungsvoll. Mit der alten Frau Kutzer, mit Atifet, mit Niyazi zusammen habe ich nach Auswegen gesucht. Und es gab Auswege: Im Alkohol, im Sex, in der Gewalt, in der Freundschaft, besonders in der Erinnerung an die goldene Zeit und dem Versprechen der Zukunft. Tragikomisch.
Heute, 44 Jahre später, bin ich jünger als Ören damals und er ist 78 Jahre alt. Er trägt Jeans, hat eine warme Stimme, spricht etwas gebrochenes, doch präzises Deutsch. „Kauderdeutsch“, sagt seine Frau. Faltiges, ruhiges Gesicht. Wenig Lächeln, wenig Bewegung. Zurückhaltend. Die Räume haben hohe Wände, an den Seiten volle Bücherregale, es ist hell. Bilder, Masken, ein Schreibtisch. Wir sitzen über Eck auf niedrigen Sesseln mit seinem Verleger Sundermeier zusammen, haben jeder ein Glas Wasser vor uns. Was hat mich her geführt? Meine erste Frage an Ören: Wie erinnert er sich an sein eigenes Leben damals in Kreuzberg?


Ein Fluss fließt nicht zurück
„Am Anfang, als ich dauerhaft zum Leben nach Berlin kam, war ich skeptisch. Was wollen die ganzen Bauern hier?“ Ihn interessierten ihre Geschichten. Obwohl selbst kein Gastarbeiter, war er auf Gelegenheitsjobs angewiesen und arbeitete in vielen Fabriken für kurze Zeit. So lernte er seine Landsleute, die es auch nach Almanya verschlagen hatte, kennen. Gleichzeitig bewegte er sich in der jungen politischen Szene und traf Studenten, Kreative, Menschen, die wie er nur schreiben wollten.
Ören startete 1965-1967 den Versuch, eine Theatergruppe für die türkischen Arbeiter in der Bundesrepublik zu gründen. 1966 kehrte er für ein Schauspielengagement nach Istanbul zurück, bis es ihn 1969 wieder nach West-Berlin zog. Dort war er Mitglied der Berliner Künstlervereinigung „Rote Nelke“. Seit 1974 arbeitete er zunächst als Redakteur und ab 1996 dann als Leiter in der türkischen Redaktion des Senders Freies Berlin (SFB).

„Die 60er, das war die Zeit in der über Politik und schöne Künste, wie sie sein sollten, diskutiert wurde. Berlin-West war ein Biotop: Drei, vier Kneipen, drei, vier Theater; das war die Szene“, erzählt er. „Ich habe meine Nase überall hin gesteckt, wo es was zu riechen gab.“ Er war auf der ersten Großdemo gegen die Große Koalition an der Gedächtniskirche, 1966. Er schaut mich schalkhaft an, als er mir erzählt, wie seine Freunde vorne standen und erklärten, sie seien seit Kriegsende SPD-Mitglieder, nur um dann, vor den Augen aller, ihr Parteibuch zu zerreißen. „So sah Protest damals aus“, sagt Ören.
„Mein Verdienst, wenn man so sagen kann, ist, ein Massenphänomen erkannt zu haben“, sagt Ören. Er hat die massive Urbanisierung in der Türkei in den 50er und 60er Jahren erlebt und auf die Migration in Deutschland übertragen. Für ihn war in den 70ern schon klar, wofür die Bundespolitik noch über dreißig Jahre brauchen würde: Dass Deutschland eine Einwanderungsgesellschaft ist.
Die Widersprüchlichkeit aushalten
„Ich wollte Visitenkarten verteilen“, sagt Ören, „zwischen den Alteingessesen und den Ankömmlingen.“ Er hat sichtlich Vergnügen an dem Bild. „Damals waren die Türken anonyme Gestalten“, erklärt er. „Man sagte auch nicht ‚Gastarbeiter’, sondern ‚Fremdarbeiter’…“ „Ein Naziwort“, wirft sein Verleger Sundermeier dazwischen. „So deutlich wollte ich es jetzt nicht sagen“, lächelt Ören zustimmend. Überhaupt hält er sich mit Bewertungen zurück, er will nicht in eine politische Schublade gesteckt werden.
Genau das, den widersprüchlichen Menschen auszuhalten, ihn nicht in eine Schublade zu stecken, hat Ören sich zum Ziel gesetzt. „Nach der ‚Naunynstraße‘ wollte ich jedes Jahr ein Buch veröffentlichen, bis die Türken als Teil der Gesellschaft anerkannt sind“, erinnert sich Ören. Es ist dann doch nur zu drei Büchern in dem Berlin-Zyklus gekommen, bestehend aus Was will Niyazi in der Naunynstraße? von 1973, Der kurze Traum aus Kagithane, 1974 und Die Fremde ist auch ein Haus, der 1980 erschien. Von dem ersten Roman hat er schon oft erzählt, die gleichen Metaphern verwendet, sodass es schwer ist, richtig vorzudringen. Obwohl die Figuren ihn nach wie vor beschäftigen, scheint Ören das alles kaum noch aufregend zu finden.
„Heute ist Berlin ja nicht mehr ohne Türken vorstellbar“, sagt Ören. Sicher, 1973 konnte der Spiegel titeln: ‚Die Türken kommen – rette sich, wer kann‘. Aber man kann auch heute noch in Kreuzberg auf Plakaten lesen ‚Neue Deutsche – Machen wir selbst!‘
„Heute ist Berlin nicht mehr ohne Türken vorstellbar.“ Aras Ören

Kreuzberg: In den 70ern eine Steppe – und heute?
Es gibt Fremdenfeindlichkeit. Sie hat sich aber verändert, wie sich das einstmals „Fremde“ verändert hat: Was es nicht mehr gibt, ist eine klar umrissene Community von Einwanderern: Es gibt viele Generationen, an vielen Orten, in vielen Gesellschaftsschichten. Mit weniger kollektiven Erlebnissen, wie dem Aufwachsen in einer ländlichen Region der Türkei, den Wunschvorstellungen eines Lebens in Deutschland, dem harten Alltag in den Fabriken, den Unterkunftslagern, der Sprachbarriere, die einen Erwachsenen zum Kind machen kann.
„Ich bin zusammen mit meinen Figuren alt geworden“, Aras Ören
Es gibt auch nicht mehr dieses Kreuzberg. Als „Tunnel“ beschreibt Ören die Naunynstraße der 70er, und als „Steppe“. Baumlos, kalt, zum Abriss frei gegeben. Ein Treffpunkt im Hinterhof, ein alter Kastanienbaum, zum Tanzen und Trinken – Ören mit Cowboyhut. Klein-Amerika. Ören hat kürzlich einen Mann getroffen, der dort groß geworden ist, in den 80ern: Selbst der konnte sich nicht mehr erinnern. Sind Örens alte Werke Fossilien? „Ich bin zusammen mit meinen Figuren alt geworden“, sagt Ören.

‚Was will Niyazi in der Naunynstraße?‘ hat nicht nur die deutsche Literaturszene bewegt. „Meine Landsleute waren es weder gewohnt, noch hatten sie Lust zu lesen“, meint Ören. „Aber zwei Dinge haben mich stolz gemacht: Wenn ein Deutscher seinem türkischen Kollegen das Buch mitgebracht hat, oder dann, wenn ein Türke es seinen deutschen Genossen in die Hand gedrückt hat.“
Wie oft das wohl passiert ist? Wer weiß. Man bekommt sein Buch heute nur noch über Antiquariate. Wenn kommendes Jahr die Trilogie neu aufgelegt wird, ist sie dann mehr als ein altes Zeitzeugnis? Auch heute kommen und gehen wir, sehen anderen dabei zu, wie sie die Fremde mitbringen und bringen selbst Fremde an andere Orte. Die Menschen sind in Bewegung, es verschlägt uns zu neuen Ufern. Wenn Ören Recht hat, dann war das immer so und wird auch immer so bleiben. Wie also damit umgehen? „Die Fremde ist auch ein Haus“, so heißt der letzte Teil der Trilogie. Ist das die Antwort?
Credits
Text: Ruth Wadenpohl
Portraitfoto: Nane Diehl
Archivfotos: „Kreuzberg 1968-2013 – Abbruch, Aufbruch, Umbruch“ von Dieter Kramer, Nicolaische Verlagsbuchhandlung GmbH, Berlin 2013.