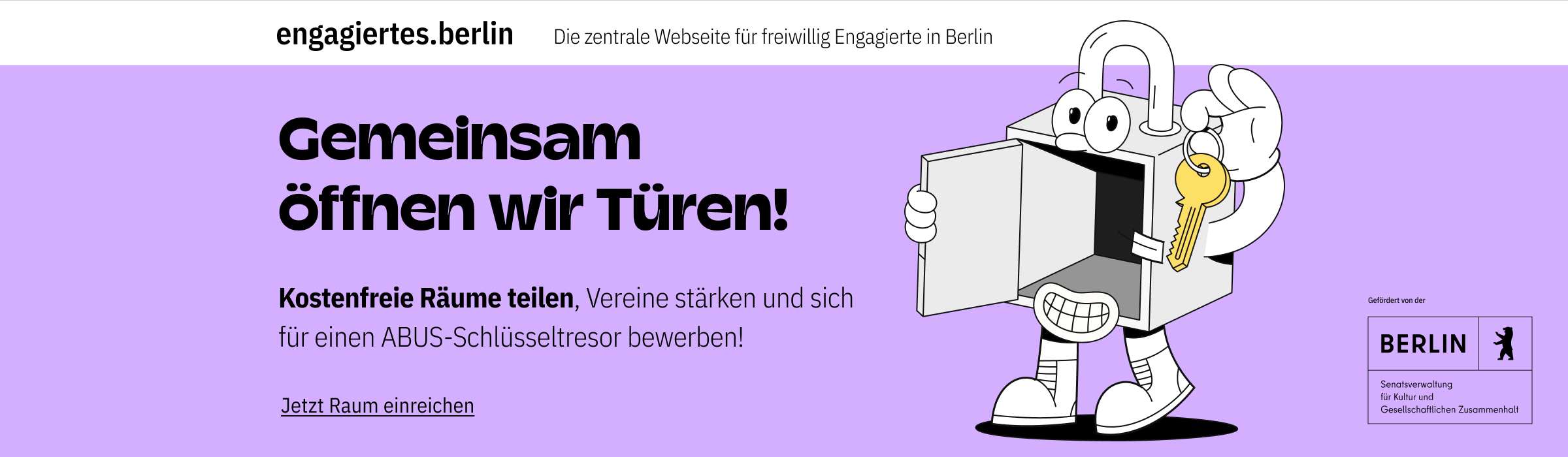amca = Onkel
dede = Großvater
bayram = Festtag
Sivas Kangal= Türkische Hunderasse
„Fahr da nicht hin, nicht jetzt!“, sagt die Stimme einer Freundin in meinem Kopf. Aber nun sind wir da: in der Türkei. In den Ländern auf dem Weg hierher waren wir Touristen. Das ist nun vorbei.
Immer, wenn ich die Türkei bereise, überkommt mich eine Art Scham, gefolgt von einem schlechten Gewissen. Diesmal ist das Gefühl stärker und ich muss an folgende Geschichte denken: Eine junge Mutter muss eines ihrer Kinder weggeben, weil sie zu viele hat und sich nicht selbst darum kümmern kann. Sie glaubt, das Kind wäre bei einer wohlhabenden Familie besser aufgehoben. Doch das Kind hängt an der Mutter und findet Wege, sie wenigstens einmal im Jahr zu besuchen. Bei jedem seiner Besuche beobachtet die Mutter voller Freude, wie gut sich das Kind entwickelt. Doch so richtig warm werden sie nicht mehr miteinander, im Gegenteil. Irgendwann wird das Kind erwachsen und die Besuche seltener. Zwischenzeitlich sind im Heimatdorf schlimme Dinge geschehen: Die gealterte Mutter wurde überfallen und massiv bedroht. Sie ist noch etwas eingeschüchtert und wackelig auf den Beinen, doch es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Das Kind in dieser Erzählung ist meine Familiengeschichte und die alte Frau unsere ehemalige Heimat, die Türkei.
Der Geburtsort von meinem baba, das Dorf Yeşilsırt, ist offiziell kein Dorf mehr, sondern ein Stadtteil von Tekirdağ geworden, einer Provinz mit ca. 1 Million Einwohnern. Die Zufahrtsstraßen dorthin sind mittlerweile asphaltiert. Dort, wo baba früher Schritt fahren musste und fluchte, wenn der voll beladene Mercedes unten aufschlug, kann man jetzt zügig durchfahren. Man muss keine Angst mehr haben, dass einem Steine von vorbeifahrenden Autos entgegenfliegen. Es scheint, als hätte hier die Lebensqualität in den letzten Jahren zugenommen.

Einst lebte mein dede Salih mit Ehefrau Güldane hier. Sie gebar ihm 12 Kinder, von denen starben 6 im Kindesalter, vier leben heute noch. Mehmet Ali amca ist einer von ihnen, er sieht meinem baba sehr ähnlich, bloß etwas dunkler und faltiger.
Mehmet Ali amca kenne ich seit ich klein bin, so auch seine vier Söhne: Hakan, Gökhan, Birol und Erol. Inzwischen haben sie eigene Familien und Mehmet Ali ist stolzer 12-facher dede. Zusammen betreiben sie ein Familienunternehmen mit Viehzucht und Ackerbau. Dazu zählen etwa dreihundert Schafe, hundertzwanzig Ziegen, dreißig Kühe, etliche Hühner, Hunde und über tausend Hektar Agrarfläche. Inzwischen geht es ihnen finanziell sehr gut, besser als vielen anderen im Dorf.

Weil ich nicht genau sagte, wann wir eintreffen würden, kommt unser Besuch überraschend. Die Ehefrauen meiner Cousins siezen mich und sind dabei herzlich und zuvorkommend. Sofort stellt eine einen großen Campingtisch unter einen Feigenbaum, wirft eine Decke darüber, stellt Stühle heran. Eine andere serviert türkischen Tee. Kurz darauf steht herrlich duftendes Essen auf dem Tisch, mit Zutaten aus dem eigenen Gemüsegarten. Wahnsinnig lecker!
 Es ist der Bauernhof, den ich noch aus meiner Kindheit kenne; dieselben beschrifteten Blechkanister als Blumentöpfe, dieselben flachen einstöckigen Lehmhäuser. Eines hat sich jedoch geändert: Jetzt gibt es im Wohnbereich eine Sanitäranlage – endlich! Vorher kackte man in ein Erdloch in einer Holzhütte hinten im Hof und wusch sich am Bach.
Es ist der Bauernhof, den ich noch aus meiner Kindheit kenne; dieselben beschrifteten Blechkanister als Blumentöpfe, dieselben flachen einstöckigen Lehmhäuser. Eines hat sich jedoch geändert: Jetzt gibt es im Wohnbereich eine Sanitäranlage – endlich! Vorher kackte man in ein Erdloch in einer Holzhütte hinten im Hof und wusch sich am Bach.
Arbeitsteilung in der Küche
Da, wo früher der Traktor untergestellt war, ist jetzt eine große Küche. Eine Frau hat hier gerade alle Hände voll zu tun. Der Schweiß tropft ihr von der Stirn, ihr sonst heller Teint ist hochrot. Mit dem Kopftuch, das eher pragmatisch als religiös motiviert anmutet, sieht sie aus wie eine Bäuerin. Heute ist sie an der Reihe. Abgesehen von dem riesigen Fliegenschwarm ist sie allein in der Küche. Die eingeheirateten Frauen wechseln sich täglich mit der Hausarbeit ab.
Hier wird das Brot noch selbst gebacken, die Pfirsich- und Feigenmarmelade selbst gekocht. Birol stellt sogar Honig her. Vor einiger Zeit ist eine der Ehefrauen in ihr Elternhaus zurückgekehrt und nahm eines ihrer zwei Kinder mit. „Das Leben auf dem Land war nichts für sie“, sagt meine Tante.
Dass die Frauen nicht bei Feld- und Tierarbeit aushelfen, hat auch pragmatische Gründe: Die körperliche Arbeit ist schwer. Die Ziegen werden noch täglich von Hand gemolken, nur das Abpumpen der Kuhmilch wurde vor einigen Jahren automatisiert. Ihr Umgangston untereinander ist ruppig, in ihren Bewegungen und Gesten spürt man die Härte des Landlebens, in ihren Gesichtern und an ihren Händen sieht man sie.

Ende der Landidylle
Auf dem Hof herrscht Frauenüberschuss. Einerseits, weil die Männer auf dem Feld oder bei den Tieren – oder im Teehaus – sind, andererseits, weil sieben der zwölf Enkelkinder Mädchen sind. Die Enkelkinder, manche von ihnen sind Teenager, nennen mich alle respektvoll Atilla amca. Mir scheint das fast übertrieben. In Berlin wird man in der Regel nur mit dem Vornamen angesprochen, manchmal sogar von den eigenen Kindern, das wäre hier nicht denkbar.
Als ich sie das letzte Mal sah, waren sie viel jünger und kleiner; ich habe Schwierigkeiten sie zuzuordnen. Wenn ich höre, dass drei der jungen Mädchen studieren wollen, überrascht es mich positiv. Bisher war ich davon ausgegangen, dass es Mehmet Ali amca und seinen Söhnen gelingt, die gesamte Nachkommenschaft zu tüchtigen Bauern und „guten Hausfrauen“ zu erziehen. Doch die Zahl der Dorfbewohner, die Land- und Viehwirtschaft betreiben, nimmt stetig ab. Die Arbeit auf dem Feld ist mühsam, die Erträge zu gering. So sterben die kleinen Familienbetriebe allmählich aus – und mit ihnen meine romantische Vorstellung vom Leben auf dem Land.
„Wände haben Ohren“
Die Älteste unter Mehmet Alis Enkelkindern macht sich nichts vor. Sie weiß, was für ein Leben sie erwartet, sollte sie jemanden aus diesem oder dem benachbarten Dorf heiraten. „Nein, ich möchte nicht heiraten, hier denken alle sehr beschränkt!“, sagt sie von den jungen Männern dort. Doch die Chancen, einen potentiellen Ehemann im zwanzig Kilometer entfernten Tekirdağ kennenzulernen, sind gering: Die jungen Mädchen haben kaum Gelegenheiten auszugehen, beklagen sie. Kaum hat eine das ausgesprochen, wird sie schon von einer anderen zurückgepfiffen: „Die Wände haben Ohren“, bedeutet man mir diskret. Gemeint ist jedoch die 8-jährige, etwas pummelige Mitfahrerin auf der Rückbank. Dann herrscht plötzlich betretene Stille bei der wackeligen Spazierfahrt in der hügeligen Landschaft. Sie sind es nicht gewohnt, solche Dinge laut auszusprechen – „ihre Freiheiten einzufordern“, denke ich für mich.
Besonders religiös sind mein Onkel und seine Großfamilie eigentlich nicht, beim Freitagsgebet in der Moschee wird man sie selten antreffen, höchstens an Bayram. Wenn ich sie vorsichtig zum Militärputsch befrage, beklagen sie lediglich die rückläufigen staatlichen Subventionen für Viehzucht und Agrarwirtschaft. Ansonsten interessiert sie nicht viel. Außer Fußball: Die Männer sind allesamt Beşiktaş-Istanbul-Fans.
Fleisch und Tod
In der notdürftig umzäunten Koppel im Schatten einiger Bäume packt Gökhan plötzlich ein Ziegenlamm am Hinterbein. Es schreit wie ein menschliches Lebewesen. Wir, die Gäste, horchen auf, schauen uns fragend an, doch niemand weiß, was jetzt kommt. Ich hab nur eine leise Ahnung. Und unser Fünfjähriger offensichtlich auch. Gökhan ruft – ohne uns vorher zu fragen! – nach unseren Kindern. Er hat entschieden, dass sie das mitansehen sollen. Unser Sohn läuft weg. In sicherer Entfernung bleibt er jedoch stehen. Meine Freundin protestiert, dreht sich weg und versucht, unsere 3-jährige Tochter festzuhalten. Sie möchte die Schlachtung nicht sehen und vor allem nicht, dass unsere Kinder das sehen. Ich finde jedoch, die Kinder sollen es selbst entscheiden. Dann geht alles sehr schnell. Unser 5-jähriger Sohn hält sich erst die Augen zu, schaut dann aber doch wieder hin. Gökhan hat das Zicklein seitlich auf den Boden gelegt. Es ist jetzt ganz ruhig, scheint sein Schicksal angenommen zu haben, als ob es wüsste, dass seine letzte Stunde geschlagen hat.
„Leben und Tod gehören zum Leben. Sie können lernen, was es bedeutet, Fleisch zu essen“, sage ich zu meiner Freundin, um sie, aber auch mich, etwas zu beruhigen. Die Augen des Zickleins sind aufgerissen. Es atmet durch den geöffneten Mund. Unsere Tochter tritt neugierig heran. Ich vertraue auf ihren Instinkt und bin sicher, dass viele Kinder in ihrem Alter solche Erfahrungen besser einordnen können als die meisten Erwachsenen. Vielleicht nimmt sie auch ihren Mut aus der Ruhe und Gelassenheit der umherstehenden anderen Kinder, für die Schlachtungen Alltag sind. Dann setzt Gökhan das Messer an die pelzige Kehle und schneidet sie durch. Das Tier zuckt ein paar Mal und bleibt dann still liegen, die Augen immer noch geöffnet. Sein Blut sickert in die Erde. Irgendwann sagt unsere Kleine: „Jetzt soll es wieder zu den anderen Lämmchen gehen.“ Ich nehme sie auf den Arm und erkläre ihr, warum das schwierig ist.

Irgendwann übernimmt Birol. Er hängt das Zicklein Kopfüber an einen Baum, nimmt es gekonnt aus und häutet es. Es soll heute Abend am Spieß gegrillt werden, eine Bestellung aus dem Dorf.
Unterdessen hat Gökhan schon den Esel gesattelt und reitet auf ihm schaukelnd Richtung Sonnenuntergang. Vierhundert Schafe und Ziegen und ein halbes Dutzend großer weißer Sivas Kangals begleiten ihn zum Horizont. Glocken läuten, Staub wird von der Herde aufgewirbelt. Unser Großer ist aufgeregt, will unbedingt mit, genau wie ich es früher wollte. Bei diesem Anblick muss ich an die Worte meines dedes denken, die er bei seinem einzigen Besuch in Deutschland in den Achtzigern an meinen Vater richtete:
„Mein Sohn, danke für deine Einladung, aber ich kann mir ein Leben ohne das tägliche Blöken der Schafe nicht vorstellen.“
Credits
Text und Bilder: Atilla Oener