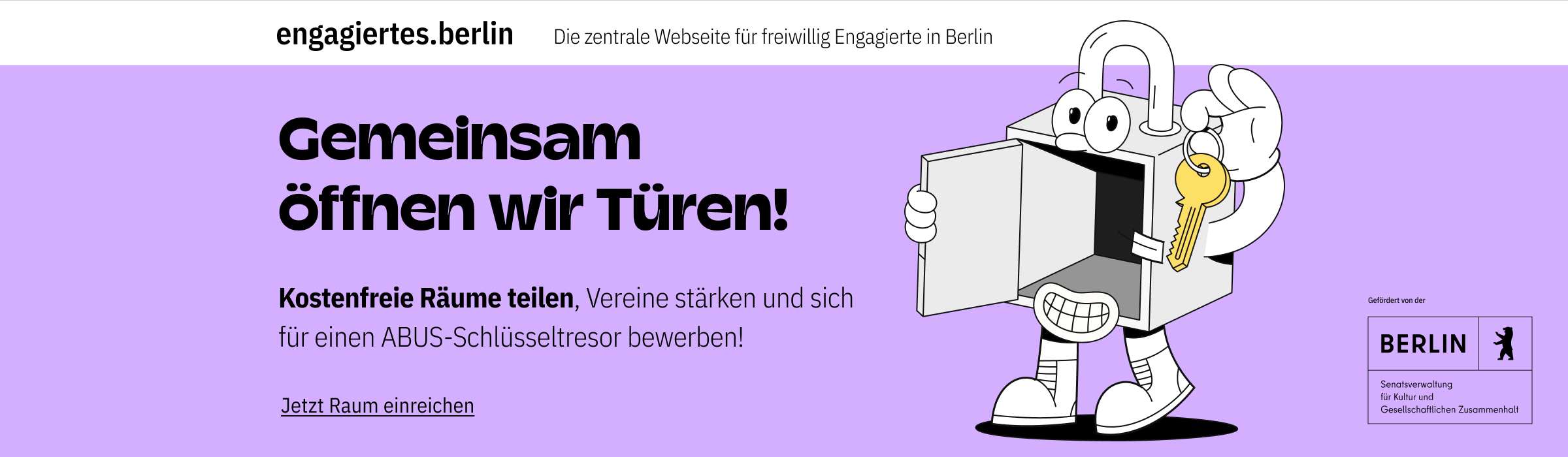Mit Ausnahme von Sonntagen ist auf dem Wilhelmplatz jeder Tag ein Markttag. Hier treffen sich viele Nippeser zum Bummeln, Kaffee und Kölsch trinken oder nur um in der Sonne zu sitzen. Gemütlich, ja fast mediterran ist es hier. Dafür sorgen auch die türkisch-kölschen Einflüsse.
Ich verlasse die KVB-Linie 15 an der Florastraße und biege links in die Viersener Straße ein, die direkt auf den Wilhelmplatz zuführt. Auf der halb geteerten, halb mit Kopfsteinpflaster belegten Meile eilen Menschen in Richtung Markt. Gesäumt von grünen Bäumen erstreckt sich der rechteckige Marktplatz unter der Mittagssonne. Als erstes schallen mir „Sehr lecker, sehr lecker!“- Rufe ins Ohr. Auf Deutsch zwar, aber mit starkem türkischen Akzent.
Am Rande des Platzes stehen zwei „Büdchen“, im außerkölschen Raum auch als Kiosk oder in Berlin als „Späti“ bekannt. Eins für die jungen Bewohner von Nippes und eins für die Alteingesessenen. Die vielen in Nippes lebenden Türken haben ihre eigenen Cafés um den Platz herum gebaut. Das junge Markt-Café nennt sich „der Kaffee Kiosk“ und bietet als Bestuhlung gestapelte weiße Getränkekisten. Nebenan ist man mittelständischer und stellt weiße Plastikstühle und Bierbänke raus. Es scheint, als seien die Sitzmöglichkeiten nach einer bestimmten Ordnung verteilt: Auf den Kisten sitzen junge Frauen und blinzeln in die Sonne. Im Schatten schwatzen beleibte Kölsche und deren frisch ondulierte Gattinnen bei Kaffee und Fleischwurstbrötchen über´s Lääve, das Leben eben.
Kaiser Wilhelm I. und das „Tadsch Mahal“
Am Kopfende des Wilhemplatzes befindet sich verweist und verdreckt eine mit Graffiti besprühte Beton-Tribüne. Auf der unteren Treppenstufe sitzt ein Paar Mitte Fünfzig. Sie korrigiert Diktate, er telefoniert lautstark. Dabei regt er sich immer wieder über einen unbekannten Mann auf und bellt Beschimpfungen in den Hörer.
Der deutsche Kaiser Wilhelm I. gab dem Platz seinen Namen. Seit dem 24. Juli 1900 findet hier jeden Tag außer sonntags ein Wochenmarkt statt. In den Sechziger- und Siebzigerjahren gehörte das Areal zu einer Ziegelei und diente unter anderem als Sandgrube. Auf dem Platz wird an Weiberfastnacht der Karneval eingeläutet, und an einem Sonntag im Monat preisen junge Nippeser und andere Kölner hier ihre Flohmarktware an. Anfang der Neunzigerjahre wurde am Kopfende des Platzes das im Volksmund als „Tadsch Mahal“ bezeichnete Multifunktions-Gebäude mit Kiosk und Toiletten errichtet.
Heute ist auf dem Markt wenig los. Dabei ist Montag – und alle müssten ihre Kühlschränke wieder füllen. Wahrscheinlich waren die anderen schon früher unterwegs. Ich laufe zwischen den Marktständen hin und her und folge den lautesten Rufen. Sie kommen vom Stand von Raif Güngor. Die Auslage sieht auf den ersten Blick frisch aus. „Bitte schön Lady, nicht vorbei laufen“, ruft mir ein Händler bezirzend zu. „Na gut“, denke ich und sehe mir die Waren genauer an. „Bitte, junge Frau?“, sagt ein anderer Verkäufer. Unentschlossen stehe ich vor dem Stand. Die Händler starren mich an und ich das Gemüse. Er lässt nicht locker: „Ok, ich kann Ihnen auch eine Tüte geben, dann können sie sich’s selbst aussuchen“.
Märkte können anstrengend sein und dabei ist wenig los. Für mich trotzdem zu viel. Menschen wuseln durcheinander, fremde Hackenporsches voller Gemüse bohren sich in meine Kniekehlen, überall wird gebrüllt. In Ruhe bummeln kann man eher nicht. Ich nehme schließlich doch ein paar Birnen, außerdem eine Schale Heidelbeeren, zu denen ich mich nach ausführlicher Überzeugungsarbeit des Händlers hinreißen lasse. Erst möchte er einen Euro dafür, dann doch nur fünfzig Cent.
Weiter geht’s. „Hoppla, bitte schön“. Der Mann, der das ruft, sagt eigentlich nicht Hoppla, sondern ein türkisches Wort, das sich aber wie Hoppla anhört. Gemeint ist hier der Begriff „oppala“, welcher im Markt-Kontext „Schaut mal her, bleibt stehen, ich hab tolle Ware!“ bedeutet. Das klingt sehr niedlich. „Eine schöne Ware, bitte schön“, brüllt er noch lauter und zündet sich eine Zigarette an. Ich beschließe, den Wochenmarkt zu verlassen und die umliegenden Geschäfte aufzusuchen.
Epochale Kleiderkunst
Das erste Geschäft liegt in der Viersener-, Ecke Auguststraße. Die Präsentation im Fenster zeigt, was mich drinnen erwartet; lange Kleider und Mäntel in frühlingshaftem Lindgrün. Ich betrete den Laden und mir fällt sofort die aufwendig bestickte Abendmode ins Auge. Außer mir und den Verkäuferinnen sind noch vier weitere Damen im Laden, und alle tragen was die Schaufensterpuppen präsentieren.
Hier ist jeder Modestil der Welt zu finden; hochgeschlossene viktorianisch angehauchte Kleider wechseln sich mit orientalischen Abendkleidern und Sixties-Modellen ab.
Im Laden ist schon der Herbst eingebrochen. Seltsamerweise auch in der „Sommer-Sale-Ecke“. Dort hängt ein Kleid, dass auch von Vivienne Westwood, der britischen Punkerin und Modedesignerin, stammen könnte. Das Oberteil des Kleides ziert ein Glencheck-Muster in grau-beige, durchzogen von roten Karos, einem schwarzen Mao-Kragen, knallroten Klappentaschen und goldenen Messingknöpfen. Mit einem raffinierten Schößchen endet die „Jacke“ über einem schwarzen Polyesterrock. Der Stoff fühlt sich unangenehm an. Trotzdem beschließe ich das Kleid anzuprobieren.
Dann springen mir weite Hosenröcke ins Auge, die ich ganz ansprechend finde. Ich frage eine Verkäuferin, bis zu welcher Größe die Modelle verfügbar sind. „Bis 52“, ruft sie mir durch den Laden zu. „Das müsste reichen“, lache ich und plötzlich lachen wir alle. Die Kabinen sind klein und schlicht. Aus den Lautsprechern dudelt türkischer Weltschmerz-Pop. In der hinteren Ecke der Umkleidekabine stehen rote Satinschuhe in kleinster Größe. Vermutlich, um sie zu den bodenlangen Abendroben anzuprobieren. Die Kabine ist eng. Mir ist warm. Kurzentschlossen verweigere ich mich dem Ankleideprozess. Ich verlasse den Laden. Es ist schwül-warm, ein typischer Sommertag in einem Kölner Sommer, der eigentlich keiner ist.
De Kaffemöhn braucht Stoff
Der Baudriplatz gleich nebenan ist fest in Mutter-Kind-Hand. Mütter um die Vierzig schieben teure Kinderwagen vor sich her und schlürfen Latte Macchiato. Ich beschließe, mich in ein Café zu setzen, da ist es schattig und kühl. Bis auf zwei spanisch sprechende Mädchen bin ich allein. Ich grüße, keiner grüßt zurück und warte danach circa zwanzig Minuten darauf, dass jemand meine Bestellung aufnimmt. Doch nichts passiert. Ich gehe zur Theke und spreche die etwas verwirrte Bedienung an. Nach weiteren zehn Minuten habe ich dann endlich meinen Milchkaffee. Wie kann ein so gemütliches Café so unwirtlich sein? Ich beschließe, weiter die Gegend zu erkunden.
Das nächste Bekleidungsgeschäft das ich aufsuche, wirkt wie eine übergroße Lagerhalle. Das Licht ist kalt. Viele Kleider hängen fein säuberlich an der Wand aufgereiht. Nur hinten in der Mitte tummelt sich ein Haufen exakt gefalteter dunkler Hosen auf niedrigen Stangen, die im Oval angeordnet sind. Die Kleider sehen aus wie im ersten Laden. Alle anwesenden Damen stehen an der Verkaufstheke und umgarnen ein Kleinkind mit türkischen Koseworten. Ich schlendere in den hinteren Teil des Ladens; die glitzernden Kleider ziehen mich einfach magisch an. Nach einer gefühlten Ewigkeit löst sich eine junge Dame aus der Frauen-Traube an der Theke und geht schnellen Schrittes auf mich zu. „Suchen Sie etwas Bestimmtes, kann ich helfen?“, fragt sie forsch. Überfordert davon, sage ich etwas schroff „Nein“. Als hätte sie mit dieser Antwort schon gerechnet, macht sie sofort auf ihrem Absatz kehrt.
Ich verlasse den Laden und umrunde den Wilhelmplatz ein letztes Mal. Vorbei an türkischen Lebensmittelläden, Reisebüros, einem Weingeschäft, zahlreichen Dönertempeln und einem türkischen Friseursalon. Vor dem sitzt ein älterer Herr. Kurz bevor ich ihn passiere, erhebt er sich und läuft langsam los. Während wir im Gänsemarsch über den Trottoir schlurfen, setzt der Gute einen sehr lauten Furz ab. Ich lache und ziehe von dannen.
Credits
Text: Roma Hering
Illustration: Sebastian Seyfarth