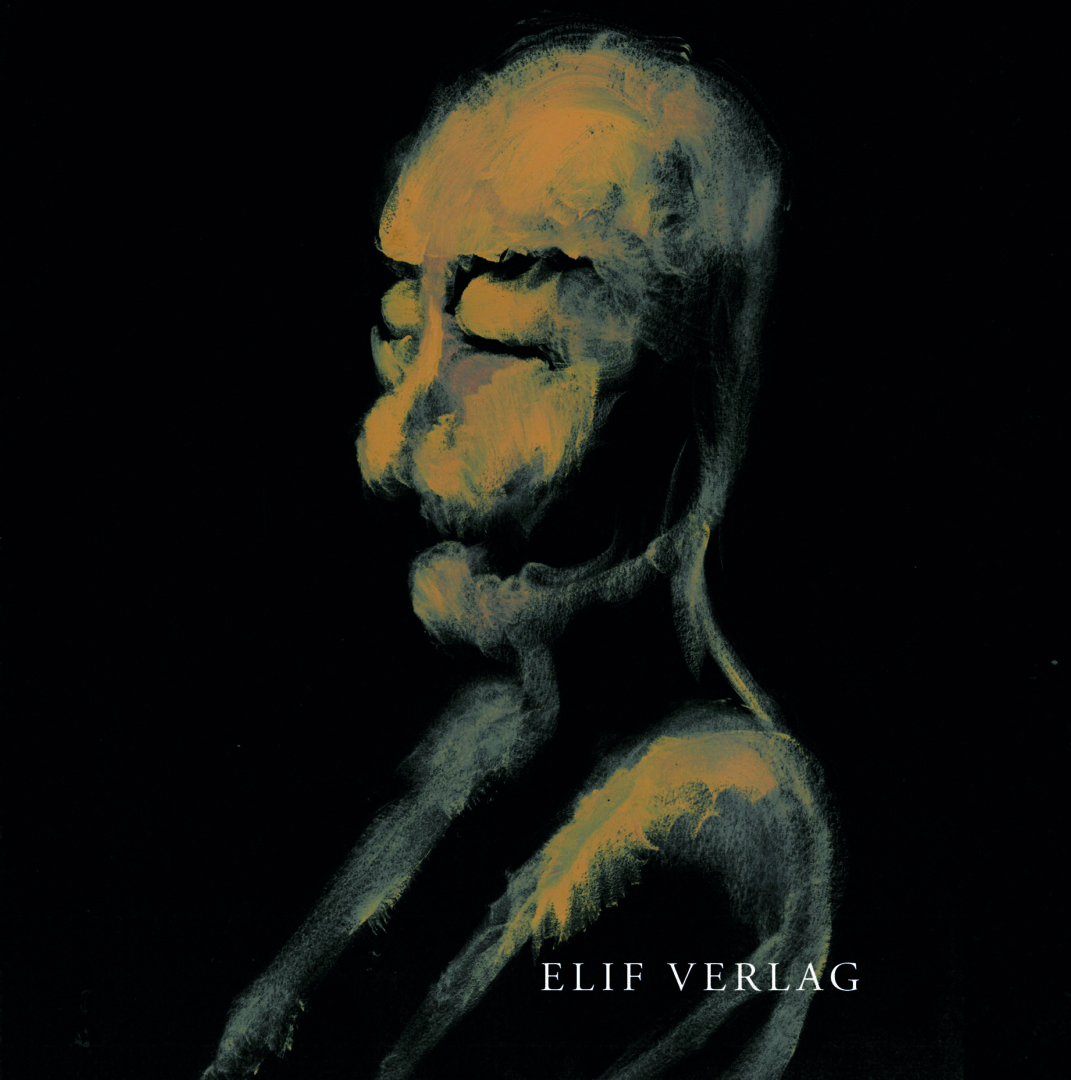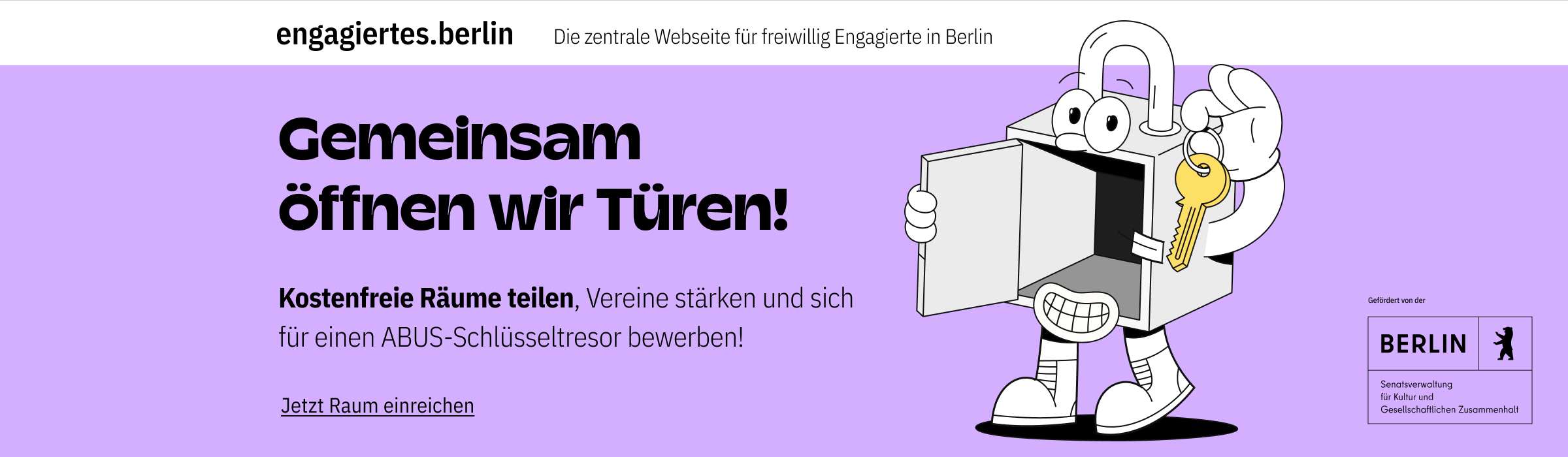Einmal im Jahr finden sich ein blaues Sofa, bunt kostümierte Manga-Fans, ein hochfrequentierter Stand mit Frozen Yogurt, Unmengen an Büchern und vor Freude strahlende Literaturbegeisterte in fünf gigantischen Glashallen ein. Es ist Buchmesse in Leipzig, und ich bin mittendrin. Am Ende ihrer vier Tage werden Zehntausende der Besucher*innen mit Eindrücken von Neuerscheinungen, Lesungen und Interviews trunken vor bücherinduzierter Glückseligkeit nach Hause getorkelt sein.
Schlichte Zurückgenommenheit
Auf meinem Stapel neuer Bücher liegt ganz oben Hakan Tezkans Roman Den Kern schluckt man nicht. Viel finde ich über Tezkan vor meiner Lektüre nicht heraus. Geboren in Göttingen, Studium am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und Veröffentlichungen in Zeitschriften sowie Anthologien, lese ich unter anderem in seinem kurzen Portrait. Mit Den Kern schluckt man nicht scheine ich nun Tezkans Debütroman in meinen Händen zu halten. Ich frage mich, ob dieser sich als so dicht gestaltet herausstellen wird wie die in ihrer schlichten Zurückgenommenheit sympathische Autorenauskunft. Auffallend ist in jedem Fall, wie schön das Buch vor mir ist – vom haptischen Erlebnis des Einbandes über das Coverbild bis hin zum Layout.

Eine Einladung, genauer hinzusehen
Den Kern schluckt man nicht umfasst drei Teile, die ihrerseits unterschiedlich viele kurze Kapitel beinhalten. Deren Titel haben Namen wie „Frühstück“, „Spiegel“, „Obstsalat“, „Käfer“, „Summer“, „Raufasertapete“, „Kirschen“, „Wolf“, „Maserungen“, „Vögel“, „Blätter“, „Heft“, „Ungeziefer“, „Scheusal“, „Schallschutzmauer“ oder auch „Tischdecke“. So unterschiedlich sie auch sind, besteht doch jeder Kapitelname aus einem einzelnen Nomen.
Ich betrachte diese lange Reihe an Substantiven – alle ohne Artikel und jegliche Deklination – und merke, wie mein analytischer Verstand in ihnen sogleich eine Kausalbeziehung oder zumindest einen übergeordneten Sinnzusammenhang erkennen möchte. Ich muss schmunzeln, denn ich merke, dass mein Ehrgeiz, die Worte zur Herstellung von Bedeutung zu beugen, ihrer grammatisch undeklinierten Form entgegenläuft. Ein weiteres Mal muss ich schmunzeln, als ich erst auf den zweiten Blick merke, dass ein Kapitel nicht mit einem Nomen, sondern mit einem Adjektiv betitelt ist: „Zweifelhaft“. Den Kern schluckt man nicht lädt mich ein, genauer hinzusehen.
Von Verhältniswörtern und gestörten Verhältnissen
„Zwischen ihm und dem Vater stand ein Holztisch“, beginnt Tezkans Roman. Nun ist das mit Anfängen so eine Sache, für mich zumindest. Nicht nur, dass ihnen ein Zauber innewohnt, wie es in Hermann Hesses Gedicht „Stufen“ so herrlich romantisch lautet. Weitaus schwerer wiegt die Erkenntnis, frei übersetzt nach einer These Edward Saids, dass der Anfang einer jeden Erzählung der „erste Schritt in der absichtlichen Erzeugung von Bedeutung“ ist.[1]
Tezkans Roman beginnt seine Erzählung mit „zwischen“, einer Präposition. Eine Präposition oder auch Verhältniswort stellt andere Worte im Satz in ein Verhältnis zueinander. Ganz unzweifelhaft geschieht dies hier mit den beiden genannten männlichen Figuren, die als erste ins Geschehen eingeführt werden. Ausgehend vom ersten Satz drängt sich mir das Gefühl eines distanzierten Verhältnisses auf – der Holztisch zwischen ihnen markiert eine starre Barriere, ein Hindernis. Gleich der Autorität, die in der Bezeichnung „dem Vater“ mitschwingt – und nicht etwa „seinem Vater“, was eine gewisse Zugehörigkeit ausdrücken würde. Doch zurück zum Romananfang, genauer gesagt zum ersten Absatz:
„Zwischen ihm und dem Vater stand ein Holztisch. Auf dem Holztisch, in der Mitte, ein Brotkorb mit Brötchen darin, Kaiserbrötchen und Kümmelbrötchen, Sesambrötchen, Mohnbrötchen. Zwischen ihm und dem Vater stand ein Glas Kirsch- und ein Glas Pfirsichmarmelade. Zwei Teller, zwischen ihm und dem Vater, auf einem Salami, Jagd- und Blutwurst geschichtet, auf dem anderen Gouda und Camembert. Dazwischen, sorgfältig angeordnet, als Dekoration, wie es die Mutter nannte, ein paar Trauben. […] Zwischen ihm und dem Vater stand eine Schale mit schwarzen Oliven und eine Untertasse für die Kerne, außerdem, an den Plätzen, drei Teller mit roter Umrandung, Teetassen aus Porzellan, kleine Silberlöffel, Eierbecher, Servietten. Zwischen ihm und dem Vater lagen drei Messer.“ (7)

Zwischen Protagonist und Vater scheint also weitaus mehr zu stehen, viel mehr als ein Holztisch. Die Frühstücksszene, die sich eingangs entfaltet, ist stimmungsgebend für den gesamten Roman. Dabei wirken die zentralen Figuren – eine Nuklearfamilie bestehend aus „M“, dem Protagonisten, und den Eltern, bezeichnet als „Vater“ und „Mutter“ – so auf sich selbst zurückgeworfen, wie die Kapiteltitel unabhängig voneinander sind. Offen bleibt durchgängig, wann und wo die Figuren verortet sind.
Vieles spielt sich in der Wohnung der Familie in einem Haus eines namenlosen Dorfes ab. Von wenigen weiteren Menschen ist die Rede, wie von Nachbar*innen, Dorfbewohner*innen oder auch einigen Verwandten, darunter einem sterbenskranken Großvater. Motive des Sterbens und (Wieder-)Entstehens prägen viele narrative Momente, so auch den folgenden, in dem M eine welke Pflanze betrachtet: „Über eines der vertrockneten Blätter der Pflanze streichend, wünschte er sich den Mund des Vaters mit ihrer Erde zu füllen, immer weiter ihn mit Erde zu füllen, bis eine neue Pflanze daraus wüchse“ (110).
Gefühle bleiben Geheimnisse
Mit kraftvollen Bildern wie diesen ist Den Kern schluckt man nicht weniger handlungs- als stimmungsgetrieben. Die Figuren sprechen zwar miteinander, doch gesagt wird dabei augenscheinlich wenig. Die den Roman durchziehenden Unbestimmtheiten – von Worten ohne Deklination, von Sätzen ohne finites Verb, von Figuren und Orten ohne Namen, vom Zustand eines im Sterben liegenden Angehörigen – erzeugen ein Gefühl der Offenheit. Doch dieser Offenheit wohnt durchgängig etwas Bedrohliches inne, etwas Unheimliches, im Freud’schen Sinne. Verdrängtes scheint kraftvoll an die Oberfläche durchdringen zu wollen. Zum Kern dieser bedrohlichen Spannung, die in allen Interaktionen dieser Nuklearfamilie unterschwellig spürbar wird, dringen jedoch zu keinem Zeitpunkt Worte durch. Die Wahrheit liegt wie so oft irgendwo zwischen den Zeilen:
„Abermals streute M Salz auf sein Ei. Dass das ungesund sei, sagte die Mutter, als sie das sah, dass sein Herz irgendwann einfach stehen bleibe, wenn er so weitermache. Herzen bleiben nicht stehen, erwiderte M, sie hören auf zu schlagen. Er sah dabei nicht zur Mutter, sah zum Vater, der wieder mit dem Löffel auf den Tisch klopfte.“ (10)
Verstärkt wird dies durch die Erzählperspektive der externen Fokalisierung. Erzählt wird aus dem Blickwinkel Ms, einem stillen Jungen im Schulalter, dessen Isolation eine schmerzhafte Mischung aus selbsterwählter und auferzwungener zu sein scheint. Parallel zu seinem beobachtenden Blick auf Mitmenschen und Umwelt können wir M dabei auch nur beobachten. Zu seinen Emotionen und den meisten seiner Gedankengänge erhalten wir keinen dezidierten Zugang. Gefühle bleiben hier weitgehend Geheimnisse. Das Auge durchzieht als Motiv den gesamten Roman, wobei auch diesem neben seiner beobachten Funktion meist eine unheilvolle oder bedrohliche Stimmung anhaftet: Pupillen verschwinden, Kinderaugen werden auf Fotografien übermalt, sie werden von grotesker Schminke umrandet oder sind blutunterlaufen. Erneut denke ich an Freud.
Innerer und eigener Schmerz
Was kein Geheimnis bleibt, ist die Aggressivität, die M gegen sich selbst richtet. Auch hier bleibt die Erzählsituation auf Abstand und lässt mich immer wieder nur beobachten: „M fuhr mit dem Ast einen Kreis nach. Er begann mit der Faust auf die blaue Stelle am Bein zu drücken und dachte an die Umkleidekabine, in der sie später sitzen würden“ (26). Über den inneren Schmerz, der sich so seinen Weg nach draußen bahnt, lese ich nichts. Diese Leerstelle, wie so viele, muss von den Leser*innen selbst gefüllt und gefühlt werden.
Das Romanende kehrt in gewissem Sinne zurück zum Anfang – und wiederum nicht. „Zwischen ihnen stand der Tisch“ (123), beginnt das letzte Kapitel. Ich habe das Gefühl, dass ich nun erahnen kann, wie es um die Verhältnisse in dieser namenlosen Familie bestellt ist, in ihrer beklemmenden Wohnung in einem unbenannten Dorf. Nicht nur damit erinnert mich Den Kern schluckt man nicht an das Zyklische menschlicher Existenz, auch in ihrer Dysfunktionalität. Die Frage, was der titelgebende Kern letztlich ist, lässt Tezkans dichtes und stimmungsvolles Debüt offen. Offen für eigene Lesarten. Vielleicht, denke ich, ist es gut, dass man den Kern nicht schluckt. Er könnte zu schwer wiegen, sich festsetzen, Wurzeln schlagen und sich verwachsen. Dann lieber nicht schlucken – und weitermachen, immerzu. In der Hoffnung, kein zweiter Sisyphos zu sein.
Hakan Tezkan. Den Kern schluckt man nicht. 1. Auflage. Nettetal: Elif Verlag. 2018.
Text: Ahu Tanrısever
Coverbild: Marijke Vissia
Autorenbild: Dinçer Güçyeter