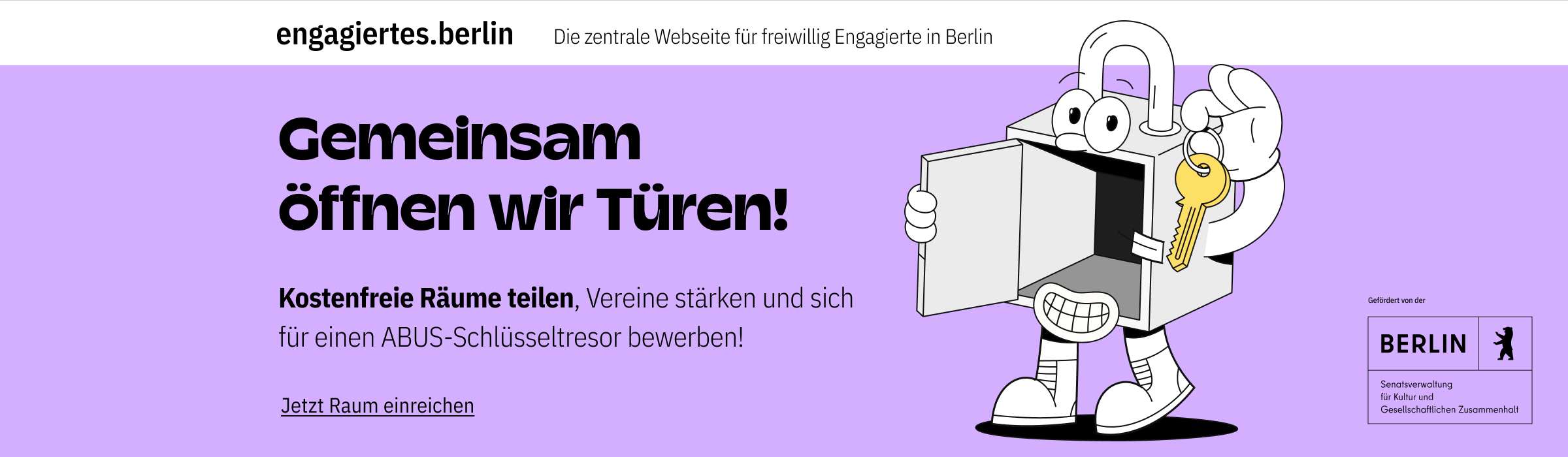Mit einem großen, farbenfrohen Blumenstrauß im Arm kommt Yilmaz Dziewior, Direktor des Museums Ludwig in Köln, das, laut Wikipedia, zu den bedeutendsten Kunstmuseen Europas gehört, schnellen Schrittes auf uns zu. Gleich darauf verschwindet er in seinem Büro am Ende des langen Flurs.
Wir sitzen, nein, versinken in Designerstühlen davor. Kurz darauf bittet uns seine Sekretärin herein. Hohe Bücherregale mit Inhalt, ein großer Schreibtisch, ein bisschen Kunst an der Wand und ein kaiserlicher Ausblick auf das Reiterstandbild von Wilhelm II., dahinter die Hohenzollernbrücke.

Können Sie einen typischen Tag von sich beschreiben?
Ich wohne im Kölner Süden, in Marienburg. Morgens fahre ich mit meinem Rad am Rhein entlang ins Museum. Meistens habe ich dann einen vollen Terminkalender. Das heißt: Ich treffe mich mit Kolleginnen und Kollegen hier im Haus. Wir sprechen über Ausstellungen, sowohl inhaltlich als auch organisatorisch. Zudem versuche ich, viele Atelierbesuche zu machen, zumeist am Morgen.
Und abends, nachdem ich meistens schon einen relativ dichten Tag hatte, gibt es Verschiedenes: Einen Vortrag, ein Treffen mit einer Künstlerin oder einem Künstler, ein Essen oder es gibt noch andere Veranstaltungen in anderen Kontexten.
Jeden Morgen fahre ich mit meinem Rad am Rhein entlang ins Museum.

Welche Fertigkeiten und Fähigkeiten braucht der Direktor des Museums Ludwig?
Soziale Kompetenz und Fachkenntnis. Beides gleichermaßen, würde ich sagen.
In welchem Bereich brauchen Sie viel soziale Kompetenz?
In der Personalführung. Ich habe 50 Kolleginnen und Kollegen. Zudem spreche ich auch viel mit Presse, Künstlern, Sammlern und potenziellen Geldgebern. Ich habe auch viel mit der lokalen Politik zu tun, sowohl mit den kulturpolitischen Sprechern als auch mit anderen Vertretern verschiedener Parteien, mit denen ich mich treffe und auseinandersetze.

Sehen Sie sich auch als Künstler?
Überhaupt nicht. Kann ich ganz kurz und knapp beantworten (lacht). Ich meine, es gibt verschiedene Kuratoren, z. B. Harald Szeemann oder Hans Ulricht Obrist, die sich vielleicht nicht als Künstler sehen, aber das Kuratieren als sehr kreative Herangehensweise begreifen. Mir ist definitiv bewusst, dass bei der Tätigkeit auch eine gewisse Kreativität im Spiel ist, aber das ist für mich keine künstlerische Kreativität.
Zum Beispiel ist für mich soziale Kompetenz in gewisser Weise auch etwas sehr Kreatives: Wie rede ich mit jemandem? Wie passe ich mich an? Über was rede ich mit welcher Person? Das ist kreativ, aber nicht künstlerisch kreativ.

Welche Kunst würden Sie machen, wenn Sie ein Künstler wären?
Meine persönliche Vorliebe ist konzeptuelle Kunst. So wäre es naheliegend, dass ich mich mit einer solchen Kunst beschäftigen würde. Aber ich finde auch Malerei interessant. Toll finde ich Kunst, die auf den ersten Blick sehr irrational aussieht, gar nicht konzeptuell. Aber ich käme nicht auf die Idee, mich künstlerisch zu betätigen. Ich habe das in der Schule gemacht und habe gesehen, dass ich da zwar ein bisschen Talent habe, aber das reicht bei weitem nicht aus, um professionell tätig zu sein.

Ihr Vater ist aus der Türkei, Ihre Mutter hat polnische Vorfahren, Sie sind in Bonn aufgewachsen. Inwiefern hat Ihr Name, also die Außenwirkung, die dieser hat, und Ihre Herkunft, also die Erfahrung mit Eltern einer anderen Herkunft als der Deutschen aufgewachsen zu sein, Auswirkung auf Ihre Arbeit?
Ich habe mich in meiner beruflichen Tätigkeit viel mit Fragen der kulturellen Identität beschäftigt, viel mit Künstlern und Künstlerinnen gearbeitet, für die das auch ein Thema ist. Auch mein dezidiertes Interesse an einer Erweiterung des Kunstdiskurses hin nach Afrika und nach Lateinamerika resultiert garantiert aus der eigenen Erfahrung mit bestimmten Erlebnissen konfrontiert zu sein. Trotzdem würde ich sagen, dass ich “utterly german” bin: Ich bin in Bonn geboren, dort aufgewachsen, habe nie Türkisch gelernt und habe auch nicht viel Zeit in der Türkei verbracht.
Weil ich keine enge Beziehung zu meinem Vater hatte, hat sich das nicht ergeben. Eigentlich hatte ich gar keine Beziehung zu ihm. Ich bin also komplett Deutsch sozialisiert. Und auch der polnische Nachname hat nicht sehr viel mit meiner Prägung zu tun, denn meine Mutter sprach nicht mal Polnisch. Auch da habe ich also nicht wirklich einen Bezug zu. Trotzdem musste ich natürlich hin und wieder erläutern, warum ich diesen Namen trage und woher er kommt. Ich möchte das nicht überbewerten, aber das hat mich und meine berufliche Tätigkeit natürlich geprägt.
Ich würde sagen, dass ich “utterly german” bin.

Wie fanden Ihre Eltern Ihren Beruf?
Mein Vater hat sich damals, als ich angefangen habe, Kunstgeschichte zu studieren, noch mehr zurückgezogen und hat gesagt, er würde mein Studium nicht finanzieren, weil das ja ein brotloser Job wäre. Er hatte dafür keinen Sinn. Meine Mutter kommt nicht aus einer bildungsbürgerlichen Familie, das heißt, auch sie konnte sich darunter nicht so richtig etwas vorstellen und dachte aber, wenn es mir gefällt, dann wird es schon etwas sein.

Sehen Sie Ihre Wurzeln und die Außenwirkung davon als Plus oder Minus im Kunstbetrieb?
Ich glaube, generell ist es ein Plus. Als ich 2000 zum Direktor vom Kunstverein in Hamburg ernannt wurde, hat mir die Kultursenatorin gesagt, dass sich die Grünen freuen werden. Die haben sich schon damals Diversität auf ihre Fahnen geschrieben. Bei sehr konservativen, reichen, älteren Leuten aber, mit denen ich auch häufig zu tun habe, ist es eher ein Nachteil. Am Anfang meiner Karriere war es eher hinderlich, nicht ideologisch oder politisch, sondern weil ich einen Namen trage, den man sich schlecht merken kann. Im direkten Kontakt mit mir wird aber eben schnell klar, dass ich Deutscher bin. Es ist nur ein Name.

Ein Journalist hat über Sie geschrieben, dass es Ihnen nicht gefalle, dass die amerikanische Sammlung des Museums Ludwig vor allem Kunst von weißen, heterosexuellen, männlichen Amerikanern umfasse. Stimmt das?
Das ist natürlich eine Verkürzung meiner Aussage. So wie er es darstellt, habe ich das nicht gemeint oder gesagt. Es geht hier nicht darum, ob es mir gefällt oder nicht. Es ist eher so, dass ich reflektiere, dass es angeblich nur diesen einen Kanon, den wir hier jetzt zeigen, gibt. Und dieser ist in unserer Institution eben im 20. Jahrhundert durch weiße, heterosexuelle, amerikanische oder europäische Männer definiert. Es ist erst in den letzten zehn Jahren der Fall, dass vermehrt auch Künstlerinnen dieser Zeitphase wiederentdeckt und hervorgehoben werden, oder dass man sich mit Fragen von Gender und Queerness beschäftigt. Auch andere Kontinente inkludierende Kunst gibt es noch nicht sehr lange in unserer Institution.
Es ist nicht so, dass ich das Werk der weißen, heterosexuellen Männer nicht zu schätzen wüsste. Ich habe ja sogar über Mies von der Rohe promoviert, den ich großartig finde und der definitiv in diese Kategorie fällt. So geht es nicht darum, einen erneut ausschließenden Kanon aufzustellen, Kunst abzuhängen, sondern den Kanon, den es gibt, aus einer anderen Perspektive anzusehen.

Können Sie ein konkretes Beispiel geben?
Ja, zum Beispiel haben wir Pollock in der Sammlung. Der passt gut in den alten Kanon. Aber interessant ist, dass er sehr beeinflusst wurde durch indianische Kunst, durch die Kunst der Ureinwohner. Wir haben jetzt auch eine Kollegin deren Stelle von der Terra Foundation for American Art finanziert wird und die sich unsere Sammlung aus anderer Perspektive anschaut.
Fragen der Diversität sind für uns sehr wichtig.

Was sind Ihre Ziele für die Zukunft?
Dass wir insgesamt diverser abbilden: Zum einen, was heute, zum anderen, was in der Kunst des 20. Jahrhunderts passiert ist.