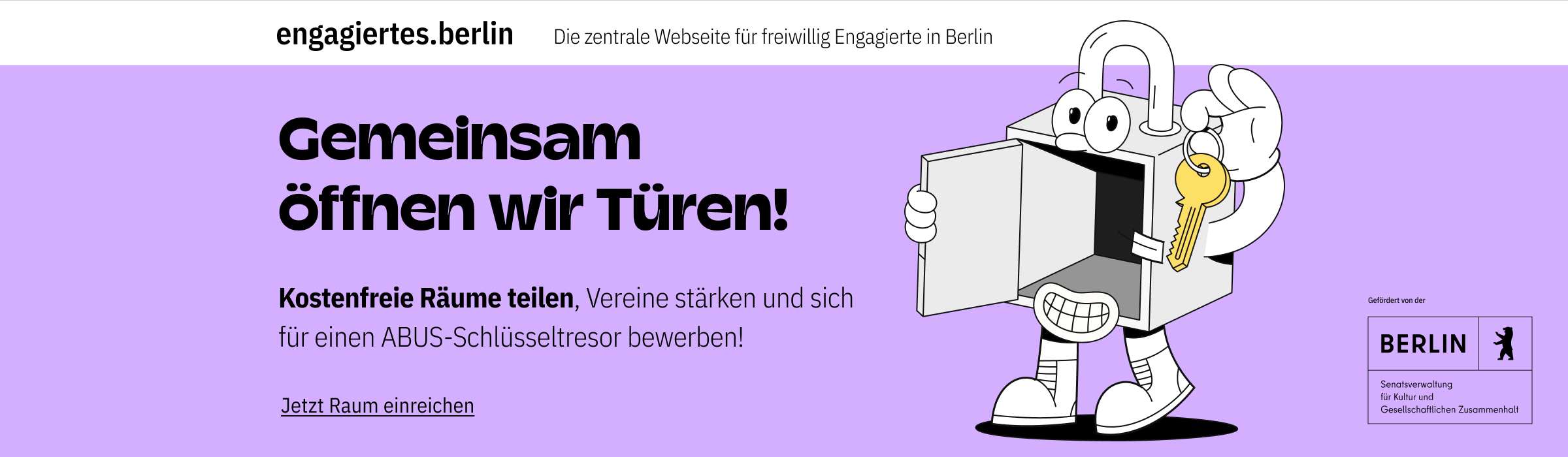Ein schönes Gefühl: in erwartungsvoller Spannung den Film entwickeln, anschließend die Negative betrachten, scannen und sortieren. Diesen nostalgischen Touch liebt Ezgi Polat an der analogen Fotografie. Der 24-jährigen Berlinerin wurde die Fotografie bereits in die Wiege gelegt. Ihre Mutter war eine begeisterte Hobbyfotografin, trug ihre Kamera immer bei sich. Diese Leidenschaft hat sie an Ezgi weitergegeben, die das Familienhobby schließlich zu ihrem Beruf machte. Letztes Jahr schloss sie ihr Studium ab und arbeitet seitdem als selbstständige Fotografin.

Du machst viele tolle Fotos, wo holst du dir die Inspiration dafür?
Das ist eine gute Frage, ich fotografiere schließlich quasi seit ich denken kann. Schon in meiner Kindheit habe ich alles geknipst, was mir über den Weg gelaufen ist. Mit 16 hab ich mir die erste richtige Kamera besorgt. Dann habe ich mich über das Fotografieren von Freunden langsam an das Fotografieren von Menschen herangetastet und viel herumexperimentiert, um so die Scheu zu verlieren. Manchmal habe ich vor einem Shooting schon Visionen im Kopf, die ich umsetzen will, aber meistens inspirieren mich die Menschen einfach aus der Situation heraus und dem gebe ich gerne nach. Damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht.
Ich schaue mir viele Fotos und Werke von anderen Künstlern an, das regt die eigene Kreativität an und es motiviert, wenn man etwas Ästhetisches und Berührendes sieht. Oder Filme! Auch Filme dienen mir als Inspiration.

Du fotografierst ausschließlich analog. Was reizt dich daran?
Ich habe mit analoger Fotografie angefangen. Zwar hatte ich auch digitale, aber es nie Spaß gemacht. Ich bin nostalgisch. Ein Film, 36 Bilder. Das Gefühl, nach dem Entwickeln endlich die Negative in der Hand zu halten, sie einzeln einzuscannen und schön zu ordnen – das genieße ich. Vorallem weiß man nicht, was dabei herauskommt! Auch wenn ich es mit der Zeit immer besser einschätzen kann, ist die Freude nach dem Entwickeln immer noch ziemlich groß, wenn dabei tolle Fotos herausgekommen sind. Mir persönlich liegt diese „altmodische“ Art der Fotografie, ich mag ihren Charme und dass ich die Technik komplett selbst beeinflussen kann – ich habe nie mit Automatik gearbeitet. Aber ich kann mir durchaus vorstellen immer mehr digitaler zu fotografieren.
Nostalgie, vielleicht auch ein Hauch von Melancholie? Das spürt man in deinen Bildern. Was möchtest du ausdrücken mit deinen Fotos?
Mir ist es wichtig, dass sie sehr emotional sind. Ich fotografiere auch selten das, was man üblicherweise unter glücklichen Menschen versteht. Dabei ist Glück ja gar nicht richtig definierbar. Manchmal wenn man in sich gekehrt ist und einfach Ruhe bewahrt, heißt das auch nicht gleich, dass man traurig ist. Melancholie ist ein wichtiges Motiv in meiner Fotografie, da ich finde, dass sie viel mehr ausdrückt als Glück. Wenn sich ein Model mir gegenüber emotional öffnet, ist das meist ein ganz stiller, leiser und trotzdem krasser Moment, den ich versuchen muss einzufangen. Das sind Augenblicke und Emotionen, die würde man so gar nicht zeigen können.

Du fotografierst von klein auf – wolltest du schon immer Fotografin werden?
Wie früher meine Mutter, war auch ich früher diejenige in meinem Freundeskreis, die immer eine Kamera dabei hatte und alles einfangen wollte, damit ich die Tage und Momente bloß nicht vergesse. Ich habe eigentlich schon immer gewusst, dass dieses Hobby auch zum Beruf werden könnte. Irgendwann habe ich realisiert, dass diese Leidenschaft immer bleiben wird. Deswegen habe ich seitdem keine Sekunde daran gezweifelt, dass es das ist, was ich studieren und später machen möchte. Und das auch nie bereut!
Inwiefern hat dir das Studium geholfen eine bessere Fotografin zu werden?
Abgesehen vom Fachlichen: Die Schule hat mich darin unterstützt, offener und lockerer zu werden. Es ist nicht so leicht, mit wildfremden Menschen zu arbeiten: sind die Models verkrampft, musst du sie dazu bringen, sich wohlzufühlen. Und bist du selbst verklemmt, merken sie das. Das sieht man den Fotos oft dann auch an.
Mit dem Studium bist du fertig. Was steht jetzt auf dem Plan?
Ich habe bereits während meines Studiums viele freie Projekte gemacht, viel mit Menschen gearbeitet und Fotos geschossen. In erster Linie geht’s ja immer darum, dass du dein Portfolio erweiterst und Erfahrungen sammels. Und genau das mache ich im Moment als freie Fotografin.

Wie gestaltet sich dein Alltag als selbstständige Fotografin?
Sehr unterschiedlich und vor allem nie langweilig. Ich arbeite ständig mit fremden, neuen Menschen, Menschen, die fotografiert werden wollen und mich buchen. Ich arbeite sehr gerne mit Schauspielern, weil die sehr offen sind und wissen, wie sie sich zu bewegen haben, damit das im Bild gut aussieht. Ich liebe es, mein eigener Boss zu sein und entscheiden zu können, wie viele Projekte ich zeitgleich betreue oder wie viele Termine ich mache. Zurzeit bin ich auch sehr auf Instagram aktiv, ich möchte damit einfach jeden, der interessiert ist, an meinem Alltag teilnehmen lassen.
Du hast Instagram angesprochen. Dort und auch überall sonst im Netz, sei es Facebook oder flickr, gibt es Fotos und Fotografen wie Sand am Meer. Was denkst du? Social Media – eher ein Fluch oder ein Segen?
Ich als Fotografin habe relativ früh angefangen zu posten, als dieser Zug gerade ins Rollen geriet. Dadurch kennen auch die meisten meine Fotos. Ich muss sagen, ich finde es eher gut als schlecht. Natürlich gibt es unheimlich viele Fotografen und unheimlich viele Bilder, die meinen womöglich ähneln, aber das ist okay. Sie lassen sich vielleicht von mir inspirieren, genauso wie ich mich von anderen inspirieren lasse. Und klar ist es ein schönes Gefühl, wenn Blogger schöne Dinge über Kunst schreiben – gerade in der heutigen Generation, wo man dazu neigt, sich über Likes und Kommentare zu definieren. Mich erreichen unheimlich viele private Nachrichten über das Internet, ich habe hier schon viele berufliche Kontakte geknüpft. Eine Reichweite und ein Feedback, das ich sonst gar nicht erhalten würde.

Mit dem Fotografieren hast du dein größtes Hobby zum Beruf gemacht. Was machst du in deiner Freizeit?
Oh, das ist gar nicht so leicht zu trennen. Natürlich treffe ich mich gerne mit Freunden, gehe auf Konzerte oder in Ausstellungen. Ansonsten entwickle ich tatsächlich oft nebenher irgendwelche Ideen, die meine Selbstständigkeit betreffen. Sei es darüber nachzudenken, ob ich meine Website erneuern muss oder einfach nur eine Idee für ein Projekt. Beruflich und privat geht bei mir quasi fließend in einander über.
Viele kommen der Kunst wegen nach Berlin, du bist hier schon geboren und aufgewachsen. Kannst du dir vorstellen woanders zu leben?
Ja, ich möchte gerne irgendwann im Ausland arbeiten. Wenn auch nur für eine Zeit. Ich glaube, ich mache das auch, ich weiß nur noch nicht wann. Ich hab zwar keine bestimmte Vorstellung, wo, aber vielleicht irgendwo, wo es wärmer ist. Klar bin ich es als Berlinerin gewöhnt, dass immer etwas los ist. Komplette Stille wäre nichts für mich. Aber ein bisschen rumkommen, durch große Städte touren, international arbeiten, das ist auf jeden Fall ein Traum, den ich habe.
Credits
Text: Carina Ebert
Interviewfotos: Nikolai Ziener