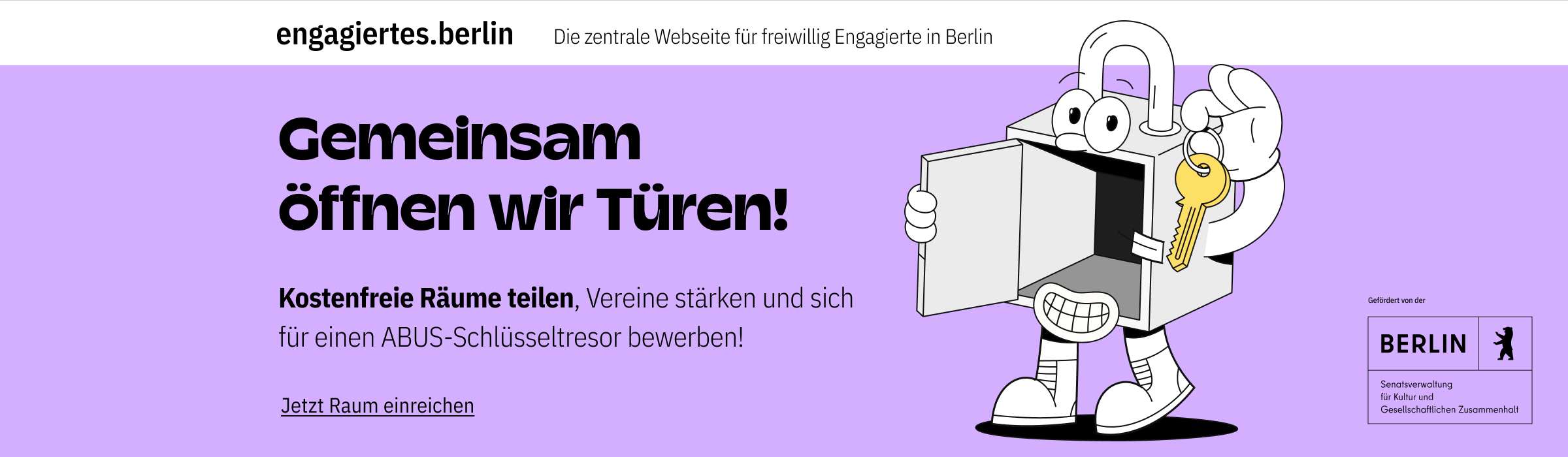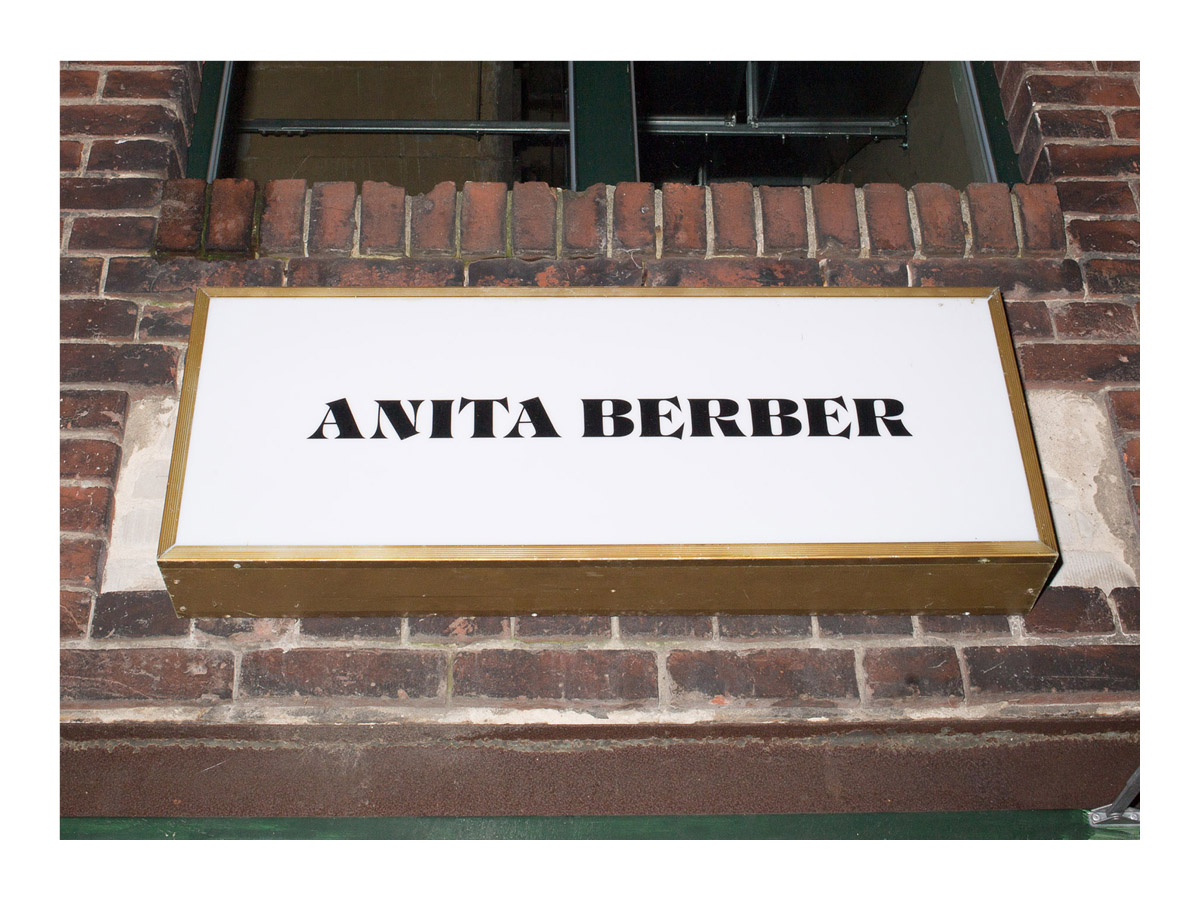Eine Novembernacht 1980 in Berlin Kreuzberg. Eine Gruppe von Menschen, mit Kerzen in den Händen, gelangt über den Innenhof in das leerstehende Haus in der Forster Str. 16-17 und besetzt es. Nachbar*innen beobachten die Szene und rufen die Polizei. Als diese eintrifft, verlassen die Besetzer*innen das Haus, ohne sich zu wehren, gehen wenig später aber wieder hinein. Am nächsten Morgen macht die Gruppe sich auf zum Bürgeramt und schließt einen befristeten Mietvertrag ab. Eine von vielen Hausbesetzungen im Westberlin der 70er und 80er Jahre, und dazu noch eine relativ unspektakuläre: keine Demo, kein großes Polizeiaufgebot, weder Straßenschlacht noch Ton Steine Scherben-Konzert.

Aber trotzdem soll gerade diese Besetzung eine besondere Stellung in der Geschichte einnehmen: die Forster Str. 16-17 war das erste von Migrant*innen besetzte Haus. Vor allem türkeistämmige und kurdische Frauen waren dabei, die meisten von ihnen zuvor Bewohnerinnen der Forster Str. 18, des Nachbarhauses, viele von ihnen arbeiteten in Fabriken. „Es waren krasse Verhältnisse damals, es lebten 29 Familien mit 50 Kindern in diesem Haus,“ erzählt Duygu Gürsel, Sozialwissenschaftlerin. Sie hat zu migrantischen Mietkämpfen recherchiert und geschrieben und war Teil des Ausstellungskollektivs Kämpfende Hütten.
Wir haben sie zu einem Spaziergang durch Kreuzberg getroffen, zu Orten migrantischen Widerstandes. Die Forster Str. 16-17 ist unser erster Stopp. „Im Bürgeramt waren die Leute natürlich schockiert: das war das erste Mal, dass so eine große migrantische Community in eine Behörde reinkam. Sie haben dann aber einen Mietvertrag bis 2016 bekommen und einige der Besetzer*innen haben auch so lange dort gewohnt. Das ist heute utopisch, dass so etwas funktioniert, aber damals war so etwas möglich, die Häuser waren nicht wie heute großen Teils privatisiert“, erzählt Gürsel weiter.

Komşular – Nachbarschaft
Die Geschichte der Besetzung der Forster Str. 16-17 ist eine Erfolgsgeschichte. Nicht nur haben die Aktivist*innen einen Mietvertrag für ein Haus bekommen, das eigentlich für eine geplante Sanierung leer stand, und das Haus durch Selbsthilfe restauriert. Die Besetzer*innen haben in ihrem neuen Zuhause eine selbstverwaltete Kita gegründet. „Komşu“ haben sie den Kinderladen genannt, zu Deutsch Nachbar*in, und es gibt ihn heute noch. Zwar nicht mehr in der Forster Straße, aber gleich um die Ecke am Paul-Lincke-Ufer spielen Kinder im Garten mit Wasserspielplatz. Dabei wird mit interkulturellem Ansatz gearbeitet und die türkische und die deutsche Sprache gleichberechtigt gelernt und gesprochen.
In den 80er Jahren leisteten die Mitarbeiter*innen von Komşu viel Nachbarschaftsarbeit:
„Es gab hier in der Forster Straße eine unsichtbare Grenze, die migrantische und deutsche Lebensräume getrennt hat, selbst die Kinder haben getrennt voneinander gespielt. Damals haben in den heruntergekommenen Häusern die Migrant*innen gelebt und in den sanierten die Deutschen.“
„Es gab hier in der Forster Straße eine unsichtbare Grenze, die migrantische und deutsche Lebensräume getrennt hat, selbst die Kinder haben getrennt voneinander gespielt. Damals haben in den heruntergekommenen Häusern die Migrant*innen gelebt und in den sanierten die Deutschen. Die Besetzer*innen wollten das ändern, auch deshalb das Engagement in der Kita. Die Idee war, über die Kinder einen Zugang zu „den Anderen“ zu bekommen, diese unsichtbare Grenze zu überwinden. Sie haben Straßenfeste und Straßenfrühstücke organisiert. Es ist eine Konvivialität entstanden. Ich glaube, das war eine schöne Zeit damals“, so Gürsel.
Rassistische Wohnungspolitik
Von einer unsichtbaren Grenze ist auch in Viktor Augustins und Hartwig Bergers Buch „Einwanderung und Alltagskultur. Die Forster Straße in Berlin-Kreuzberg“ aus dem Jahr 1984 zu lesen: „Man sieht hier im Kleinen, wie die ‚Ballung‘ von Arbeitseinwanderern durch die Belegungspolitik derselben Eigentümer erzeugt wird, die sich anderswo so sehr um die Erhaltung des Deutschtums bemühen. Gute Häuser den Deutschen – die schlechten den Türken – Geschäftssinn und Rassismus verbinden sich harmonisch.“

Die Autoren sprechen einen Punkt an, den auch Duygu Gürsel betont: im Jahr 1963, als West-Berlin begann, Arbeiter*innen aus dem Ausland anzuwerben, wurden die Stadtteile Kreuzberg, Wedding und Neukölln zu Sanierungsgebieten erklärt. Es sollten sogenannte „Kahlschlagsanierungen“ vollzogen werden. Damit ist gemeint, dass die alten Gebäude abgerissen und neue gebaut werden sollten. Das sollte zehn bis zwölf Jahre später stattfinden, bis dahin sollten die Häuser entmietet werden. „Es gab die Idee, diese Wohnungen in der Zwischenzeit an ‚Gastarbeiter*innen‘ zu vermieten. Sie dachten, das sei eine kluge Entscheidung, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass die Arbeiter*innen hierbleiben werden. Außerdem sind sie davon ausgegangen, dass die deutschen Mieter*innen sich erschrecken werden, wenn ‚die Türken kommen‘, und dann von selbst ausziehen. Das war die Strategie. Zudem wurden die Häuser vernachlässigt, nichts wurde mehr repariert.“, erzählt die Sozialwissenschaftlerin. Migrant*innen hätten sonst aber kaum eine Chance auf bezahlbaren Wohnraum gehabt:
„Es war ganz üblich, dass in Anzeigen explizit stand ‚keine Wohnungen für Ausländer‘. Im Heim wollten viele nicht leben, so ganz isoliert und ohne Privatsphäre.“
Hier machte die rassistische Wohnungspolitik aber noch keinen Halt: es gab einen „Ausländerzuschlag“, das heißt, Vermieter*innen konnten von „Gastarbeiter*innen“ mehr Miete verlangen. Ab 1975 galt zusätzlich eine Zuzugssperre für „Gastarbeiter*innen“ für die Stadtteile Wedding, Tiergarten und Kreuzberg. Duygu Gürsel bezeichnet diese Maßnahme als indirekte Abschiebepolitik. „Aber auch das hat nicht funktioniert. Die Menschen haben sich dagegen gewehrt und die Politik unterwandert, mit Scheinanmeldungen und Strohmännern. Das hat sie in eine Grauzone, oft in die Illegalität gedrängt und ihren Status noch prekärer gemacht.“
Die Oranienstraße 14a – selbst sanieren, um bleiben zu können

Bei unserem Spaziergang durch Kreuzberg sind wir mittlerweile am Heinrichplatz angekommen. Cafés und kleine Geschäfte säumen den kleinen Platz, Spaziergänger*innen bringen das Laub am Straßenrand durcheinander. Duygu Gürsel deutet auf ein schmales, hellgrünes Haus, die Oranienstraße 14a: „Hier wurde nicht besetzt, sondern die Bewohner*innen haben gegen die Entmietung gekämpft. Sie wollten hier wohnen bleiben.“ Die Haussprecherin Çiğdem Eren schreibt damals:
„Der Weg war nicht leicht; […] aber aus der Not wurde eine Notwendigkeit, Widerstand zu leisten. Die Mieter merkten, dass sie zusammen stark sind, dass man auch in einem fremden Land etwas erreichen kann, wo man eher nur geduldet als willkommen ist.“
Die Bewohner*innen gründen eine Hausgemeinschaft und schicken Mängellisten an die Wohnbaugesellschaft SAMOG: das Dach ist undicht, die Fenster lassen sich kaum schließen, es gibt lediglich drei Außentoiletten für acht Mietparteien, die ständig verstopfen. Nachdem die Mängel nicht beseitigt werden, vermindern die Mieter*innen ihre Mietzahlungen. Es beginnen Verhandlungen mit der SAMOG, die beharrlich versucht, die einzelnen Mietparteien zum Auszug zu bewegen. Die Wohnbaugesellschaft versucht, es auszunutzen, dass in sechs der acht Haushalte Familien aus der Türkei lebten, die zum Teil nicht fließend Deutsch sprechen.
Zusammen mit Architekt*innen und einem Mieterladen aus der Dresdener Straße entwickeln die Mieter*innen einen Gegenentwurf gegen die Sanierungspläne für ihr Haus. Sie erneuern beispielsweise die Sanitäranlagen selbst und stellen die Kosten dafür der SAMOG in Rechnung. Nach weiteren Verhandlungen und Kampfansagen der Bewohner*innen wird ihren Forderungen nachgegeben: die Mieter*innen beginnen, das Haus großen Teils selbst zu sanieren. Sie sind laut Erens Bericht nach Beendigung der Sanierungsarbeiten zufrieden mit ihrem Projekt. Eine*r von ihnen wird zitiert: „Anfangs ist es uns sehr schwergefallen, aber jetzt sind wir glücklich, dass wir es geschafft haben und dass unsere Mieten niedrig geblieben sind. Alle beneiden uns, dass wir in so großen Wohnungen mit einer so niedrigen Miete wohnen. Dann gebe ich ihnen die Antwort, dass wir uns als Mieter zusammengeschlossen haben und gemeinsam gearbeitet haben […] Ich würde alles noch einmal machen, wenn es sein müsste.“
Die Frauen allen voran im Häuserkampf
In Çiğdem Erens Bericht wird das besondere Engagement der Frauen beim Kampf gegen die Entmietung hervorgehoben: „Ich will sagen, dass sich die Frauen entschlossener gegen den Sanierungsträger gestellt haben, dass sie engagierter zur Entwicklung des Hauses beigetragen haben. Sie waren mit Begeisterung bei der Sache.“ Und auch Duygu Gürsel betont die wichtige Rolle von migrantischen Frauen: „Die Frauen waren so aktiv, weil sie besonders von der Wohnpolitik betroffen waren, weil sie keinen Ort hatten, zu dem sie vor häuslicher Gewalt fliehen konnten. Die Kämpfe, die sie führten, waren aber auch ein Aufschrei gegen die Opferdarstellungen von migrierten Frauen, die damals dominant waren.“
In der Kottbusser Straße 8, dem letzten Stopp unseres Spaziergangs mit Duygu Gürsel, waren es ausschließlich Frauen, die Mitte Februar 1981 besetzten. Die Besetzerinnen waren im TIO e.V., dem Treff- und Informationsort für Migrantinnen aktiv, den es heute noch gibt. In einer Alphabetisierungsgruppe des TIO entschließen sich acht Frauen spontan, am nächsten Tag zu besetzen. Wie die Forster Straße 16-17 sollte auch die Kottbusser Straße 8 saniert werden. Zum Zeitpunkt der Besetzung sind jedoch schon Handwerker*innen im Haus.

Wir sind der Chef!
Eine der Besetzerinnen, die spätere Grünen-Politikerin Sevim Çelebi-Gottschlich beschreibt in einer Broschüre der Allmende e.V. zu migrantischem Widerstand ausführlich, was geschah: „Am Mittwoch trafen sich alle acht Frauen mit [ihren] vier bis fünf Kindern in dem Vereinsladen. In der Lausitzer Straße ging die Gruppe los. […] Sie wussten nicht, was sie erwartete, […] alle waren sehr aufgeregt.“ Als die Aktivistinnen mit ihren Kindern das Haus in der Kottbusser Straße betreten, werden sie von den anwesenden Handwerkern rassistisch angegriffen: „Euch sollte man vergasen“, sagt einer und wird sogar handgreiflich. Schließlich verschaffen sich die Frauen Zutritt zu einer der Wohnungen und schließen sie hinter sich ab. Die Handwerker versammeln sich vor der Wohnungstür und schreien, dass die Frauen rauskommen sollen. Die Besetzerinnen beschließen, kein anderes Wort als den Namen des Innensenators zu sagen: „Im gleichen Tempo riefen alle gemeinsam ‚Ulrich, Ulrich, Ulrich, …!‘ Kurz danach kam die Polizei. Sie hatten keinen weiteren Dialog mit den Polizisten, die vor der Tür standen und zu ihrem ‚Schutzengel‘ gegenüber den Bauarbeitern wurden“, so Çelebi-Gottschlich.
Nach einiger Zeit kommt eine Gruppe Unterstützer*innen vor dem Gebäude zusammen, sie werfen den Frauen Schnuller und Milch für die Kinder auf den Balkon, und ein Transparent mit dem Schriftzug „Nur Mut“. Die Besetzerinnen harren mehrere Stunden in der Wohnung aus, ohne zu wissen, was als nächstes passiert. „Plötzlich kam ein Mercedes, ein Herr Kräuter von der GSW. Die Polizei öffnete das Haustor und die Frauen schlossen die Wohnungstür auf.
„Er fragte sie, ‚Wer ist hier die Chefin?‘. Die gemeinsame Antwort lautete: ‚Wir sind der Chef!‘“
Zwanzig Minuten später haben die Frauen den Hausschlüssel. „Es war irgendwie komisch, es war kein richtiges besetztes Haus, nicht ‚revolutionär genug‘ gegen diesen ‚Schweinestaat‘, so nannte die Bewegung den Staat.“, so Çelebi-Gottschlich. Die Besetzer*innen aus der Forster Str. 16-17 kommen mit Blumen, um zu gratulieren. Es ziehen linke Deutsche ein und migrantische Familien. „Natürlich waren die BewohnerInnen mit den sozialen Problemen der Migrant*innen überfordert.“, schreibt Çelebi-Gottschlich.
„Integration im Imperativ funktioniert nie.“
Duygu Gürsel zeigt uns den Balkon, von dem das „Nur Mut“-Transparent gehangen hatte. „Der Plan war, in diesem Haus ein Integrationsprojekt zu starten, einen Ort zu schaffen, an dem deutsche und türkische Familien zusammenwohnen. Ich weiß nicht, ob das wirklich ihr Ziel war, oder ob sie das nur deklariert haben, um das Okay vom Senat zu bekommen. Ich denke jedenfalls, dass das einer der Punkte war, an denen es gescheitert ist. Integration im Imperativ funktioniert nie, die Gemeinschaft hat sich nicht organisch entwickelt.“, erzählt sie. Es sei ein Betreuungsverhältnis zwischen den deutschen linken Familien und den ursprünglichen Besetzerinnen entstanden, sagt sie weiter. Die Aktivistinnen hatten neben der Fabrikarbeit, dem Haushalt und der Kinderbetreuung wenig Energie für Plena und Demos. Nach und nach zogen die migrantischen Familien aus, die Kottbusser Straße 8 wurde irgendwann „Kommunistenhaus“ genannt. Heute wohnt keine der Besetzer*innen mehr dort.

Eine Lücke in der dominanten Geschichtsschreibung
Migrantische Hausbesetzer*innen setzten sich mit ihrem Kampf gegen die Wohnpolitik größerer Gefahr aus als Menschen mit deutschem Pass – durch illegale Aktivitäten drohte ihnen teils die Ausweisung, bei der Konfrontation mit der Polizei und den Behörden waren rassistisch Drohungen kein Einzelfall. „Sie hatten natürlich Bedenken. Aber es ging einfach nicht anders. Sie wollten zeigen: es kann nicht sein, dass Menschen so leben müssen. Die Zustände haben sie dazu gebracht, zu handeln“, erzählt Duygu Gürsel.
Warum aber sind linke Kämpfe von Migrant*innen in der dominanten Geschichtsschreibung in den Hintergrund gerückt? Duygu Gürsel hat eine Antwort: „Aus politischer Sicht waren diese Kämpfe nicht als solche wahrnehmbar.
„Die Selbsthilfeorganisationen, die damals gegründet wurden, die wenigen Hausbesetzungen, die es in Berlin gab, und die Tatsache, dass sie trotz der Erwartung, dass sie wieder gehen würden, hiergeblieben sind: das alles gehört zu den Kämpfen“
Der Widerstand richtete sich nicht nur gegen die rassistische Politik, sondern auch gegen die Stadtpolitik der Verdrängung. Der Plan, der hinter den Kahlschlagsanierungen steckte, war, die Armen genauso wie die Migrant*innen loszuwerden. Der Widerstand war aber nicht im klassischen Sinne organisiert, die Leute haben’s einfach gemacht, weil es nicht anders ging. Deshalb wurden migrantische Kämpfe als marginal empfunden.“
Die Sonne geht langsam unter, der Himmel über Kreuzberg färbt sich rot, eins will Duygu Gürsel aber noch hinzufügen, bevor wir unseren Spaziergang beenden: „Es gibt diesen Widerstand immer noch. Irgendwie wollten die Leute aber schon immer mehr darüber hören, wie Menschen unterdrückt und ausgebeutet werden, dass sie unter repressiven Bedingungen leben. Das passiert natürlich, deshalb wird ja gekämpft. Sobald die Unterdrückten aber aus der Opferperspektive austreten und Subjektivität beanspruchen, wird es für viele Leute schwierig, solidarisch zu sein. Den Widerstand in den Fokus zu rücken, ist wichtig.“
Text: Lisa Genzken
Fotos: Kiki Piperidou