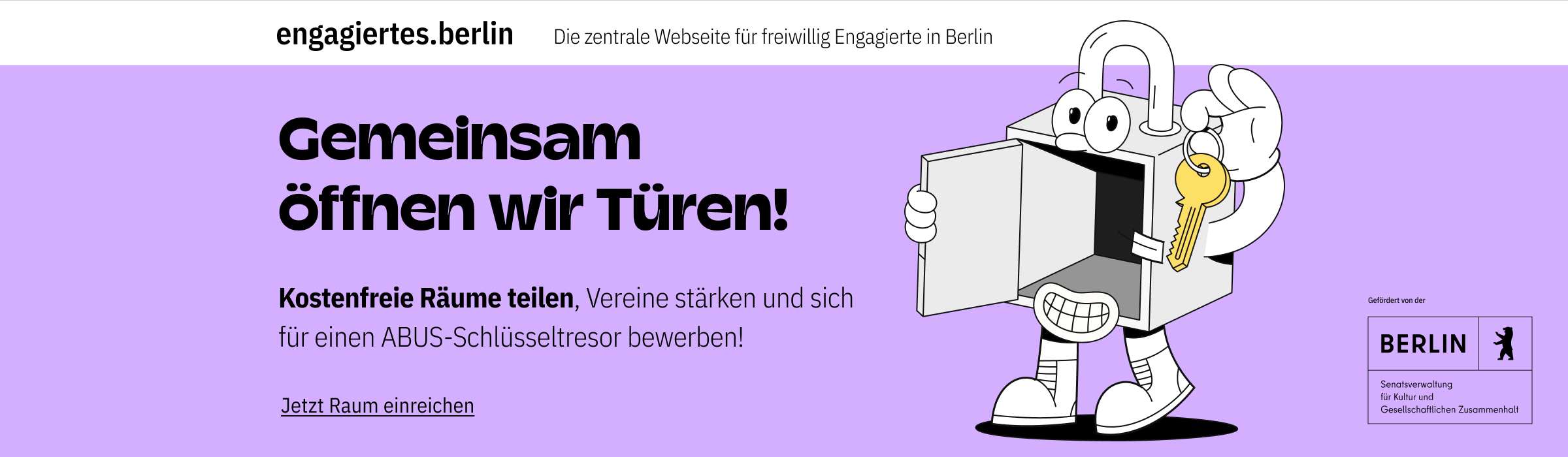Will man mit der Zeit gehen, ist es unausweichlich, archetypische Merkmale mit der Gender-Feile zu polieren. Für mich bedeutete das, vieles, was mir baba zuhause vorlebte, zu hinterfragen. Dafür werde ich anne immer ähnlicher. Meine Gender-Migration.
Türkische Vokabeln
anne – Mutter
baba – Vater
küçük cocuk – kleiner Junge
sağ olun – danke euch
uff – aua
Marxloh – 1980
Als kleiner Junge war ich nicht gerade propper: Mein Bauch stand leicht aufgebläht hervor und darüber konnte man meine dünnen Rippchen zählen. Das war zu der Zeit, als Bilder von unterernährten kleinen schwarzen Kindern aus der sogenannten dritten Welt über die Fernsehschirme flimmerten und den Erste-Welt-Menschen das Abendbrot im Hals stecken bleiben ließen. Regelmäßig zerrte mich dann anne zu Frau Doktor Buschmann, einer betagten Dame, die von Krieg und Hunger ein Lied singen konnte. Und die zwei Frauen waren vereint in der Befürchtung, ich sei unterernährt. Annes Ängste, dass Aasgeier mich auf dem Nachhauseweg vom Kindergarten verschleppen und vernaschen könnten, hatten zur Folge, dass ich solange am Tisch sitzenbleiben musste, bis mein Teller leergegessen war. Zum Nachtisch gab’s einen eisenhaltigen blutroten Trunk, der meinen ganzen Körper zucken ließ, wenn ich ihn brav runterwürgte.
Baba bekam davon kaum etwas mit; Erziehung, Gesundheit, Kinderbetreuung waren wie üblich annes Baustelle. Er musste ja draußen mit der Keule auf die Jagd gehen, wenn er nicht gerade zwischen den Schichten im „Männer-Café“, also im türkischen Teehaus, saß oder auf dem Sofa in der Küche schnarchte, und wir uns in Zeitlupe bewegen mussten, um ihn nicht zu wecken. Das war damals.
Berlin – 2016
Heute ist der küçük cocuk selbst baba, dem allerdings männerlastige Teehäuser ähnlich fremd sind wie das nachmittägliche Schnarchen. Wobei, einen Sessel gibt es tatsächlich in unserer Küche, und meine Freundin wundert sich manchmal, zu welch unterschiedlichen Tageszeiten man mich in der Horizontalen antrifft. Doch abgesehen von der urtümlichen Geborgenheit, die babas meditativem Schnarchgesang immerhin innewohnte und die ich meinen Kids gern weitergeben möchte, war’s das aber auch mit den Gemeinsamkeiten. Heute sind die Aufgaben anders verteilt. Jeder fühlt sich für alles verantwortlich. Ohne Kommunikation, Terminabstimmung, Flexibilität würde der Laden nicht laufen. Jeder kümmert sich um Haushalt, Kinder, Wäsche, Küche, Einkäufe und Rechnungen gleichermaßen.
Und wenn ich mich im Kampf gegen hartnäckiges Bratfett doch mal dabei ertappe, wie ich mich frage: „Was ist nur aus dir geworden? Was bist du eigentlich für ein Mann? Wie siehst du überhaupt aus?“ und „Wie konnte es eigentlich soweit kommen, dass man dich zum Küchenchef degradiert hat?!“, dann halte ich inne und erinnere mich an baba und das kleine Dorf im Westen der Türkei, in dem er aufwuchs. Ich denke an all die Männer in den Caféhäusern; jung, alt, wie sie leben, sich geben, Frauen begegnen und betrachten. Ich stehe dann da mit dem Topflappen in der Hand und komme aus dem Staunen nicht mehr heraus, wie klein ihr Bewegungsraum, ihr Horizont und wie eng ihre Welt doch … ufffffff! Plötzlich krümme ich mich vor Schmerzen. Irgendwas hat mich genau zwischen den Beinen erwischt und mich aus meinem Tagtraum herausgehauen. Ich schaue runter und sehe, wie mein fünfjähriger Sohn mich frech angrinst. Spontan kommt mir der Gedanke: „Es kann nicht schaden zu wissen, wie man sich gegen jemand Überlegenen durchsetzt.“ Und dann weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll.
Wie die Mutter so der Sohn
Wenn ich so durch den Supermarkt schlendre, der Einkaufswagen vollgepackt mit dem Nötigsten, beim Textilien-Ständer kurz anhalte und mich frage, was es wohl heute so im Angebot gibt, anschließend nach Unterwäsche, Socken und lieblosen T-Shirts für die Crowd zuhause fische, muss ich plötzlich an die schlechten Arbeitsbedingungen denken, unter denen die Sachen hergestellt werden. Dann verspüre ich ein leises Unbehagen und frage mich „Wie viele Socken braucht der Mensch?“, und lande schließlich ich mit meinen Gedanken bei anne. Ich sehe sie vor mir, wie sie ihren vollgepackten, quietschenden, zweirädrigen Einkaufswagen hinter sich herzieht, voller Milch-, Mehl- und Zucker. Dazwischen T-Shirts und Unterwäsche vom Wochenmarkt auf dem August-Bebel-Platz in Marxloh – Sachen, die nur ihren Zweck erfüllten, die keiner von uns tragen wollte, aber alle tragen mussten. Und wieder Zweifel: „What am I doing here?!“ Ich tausche die Socken gegen laktosefreie Milch ein und gehe zur Kasse.
 Die Ruhe weg
Die Ruhe weg
Wenn ich kurz davor bin, beleidigt zu sein, weil die Kids lieber Fischstäbchen essen wollen als wahnsinnig aufwändig zubereitete Kohlblätter mit Hackfleisch, und mir Sätze rausrutschen wie „Wisst ihr überhaupt, wie lange ich heute am Herd gestanden hab?“, fühlt es sich an, als würden annes Worte in mir nachhallen. Oder wenn ich wieder am Esstisch meinen Sohn dazu drängen will, seinen von mir viel zu vollgepackten Teller aufzuessen, weil irgendeine unbegründete Angst mich glauben lässt, er könnte nicht genug zu Essen kriegen, sollte ich einfach gelassen bleiben und schmunzeln, weil ich jeden Tag Neues entdecke, das mir auf den zweiten Blick bekannt vorkommt. Und das, obwohl ich mir fest vorgenommen hatte, einiges anders zu machen, wenn ich mal eigene Kinder hab.
Türken sind ein abergläubisches Völkchen. Vielleicht werde ich ja auch von annes Fluch verfolgt, den sie damals häufig ausstieß, wenn ihr die Baustelle mit den Kids, dem Haushalt, dem Kochen und den Einkäufen wieder mal über den Kopf wuchs: „Ich wünsche euch, dass ihr mal eigene Kinder habt und ihr euch jeden Tag überlegen müsst, was sie essen sollen, und dass ihr ihnen hinterherlauft, damit sie auch essen, was ihr gekocht habt.“
Verzeih, anne, dass wir manchmal so ungezogen waren und deine Arbeit nicht genug gewürdigt haben. Manches kann ich jetzt nachvollziehen, jetzt bin ich du und auch du, baba.
Sağ olun.
Mehr von Atilla gibt es unten im nächsten Beitrag: „Irgendwann geht’s zurück“