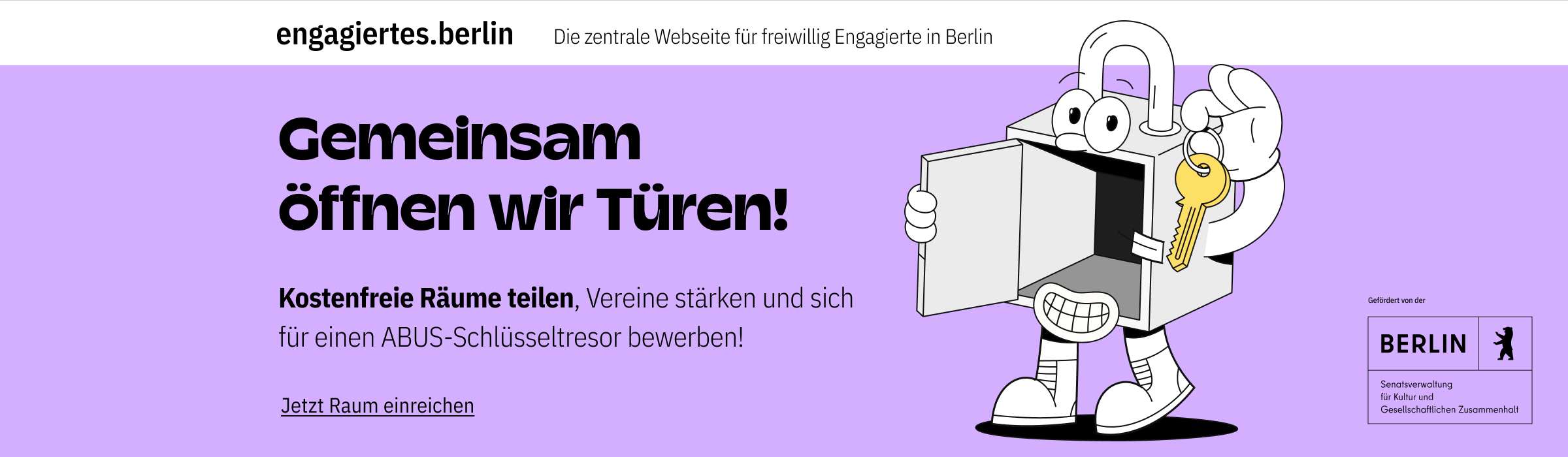Auf halben Weg in Richtung Türkei hat man den Eindruck, als hätten die Osmanen fünfhundert Jahre zuvor einen Orientteppich über den Balkan ausgelegt und wir würden nun an seinen verstaubten Überbleibseln entlangfahren.
Der ca. 60-jährige Vermieter des Apartments in Kotor spricht etwas Deutsch, weil er wegen des Balkan-Krieges einige Zeit in Deutschland gelebt hat. Die Frage nach dem Verhältnis zu den Anrainerstaaten wischt der Montenegriner lässig mit einer Armbewegung weg und sagt darauf: „Die Menschen hier lernen nicht dazu, sie sind selbst schuld, wenn sie zulassen, dass andere einen Keil zwischen sie treiben.“ Als ich frage, wen er mit „die anderen“ meint, zuckt er mit den Schultern, sagt leise und verdrossen: „Die Amerikaner“.
Wildes Albanien
Nachdem ich die Glühbirne am Auto ausgewechselt habe, verlassen wir die Küste und fahren landeinwärts durch die Berge Richtung Albanien. Dabei hallen Babas Worte in meinem Ohr nach: „Meide Albanien! Zu undurchsichtig!“ Doch die Neugier ist zu groß, um uns vom Weg abbringen zu lassen. Und so stehen wir bald in der Schlange zum Grenzübergang. Warum hier lediglich nur ein Fahrzeug im Fünfminutentakt passieren darf, bleibt schleierhaft. Grenzbeamte in braunen, teilweise etwas zu großen Hemden laufen umher, ein Hauch lethargischer Willkür liegt in der Luft. Diese Beamten wollen es nicht eilig haben. Erst als ich der Frau im Häuschen auf die Frage hin, wo wir denn hinfahren wollen, „Istanbul, Istanbul …“ antworte, lächelt sie freundlich. Womöglich kommen hier nicht viele Menschen vorbei, die nach Istanbul wollen. Vielleicht gehören auch die Albaner zu den wenigen auf dem Balkan, die den Osmanen die 500 Jahre Unterjochung nicht nachtragen.
Am Rand der Landstraße mitten in der kargen Landschaft stehen Luxus-Restaurantoasen mit integrierten bunten Pastik-Kinder-Spiel-Plätzen, wo junge Kellner in Weiß umherflitzen und sich um das Wohl der Gäste kümmern. Davor parken fette, polierte SUVs und Limousinen. Im Vergleich macht Albanien auf dem Balkan den ärmlichsten Eindruck auf uns. Die verstohlen-misstrauischen Blicke, die man im Vorbeifahren erhascht, die saftige Vegetation, die unbefestigten Wege und mächtigen Gipfel in der Ferne verleihen dem Land einen unberührten, eigentümlich-wilden Charakter. Vielleicht ist es aber auch der dunkle Schatten des sogenannten „albanischen Alleingangs“ unter Präsident Enver Hoxha, der sich aus der Vergangenheit auf die Gegenwart wirft: Hoxha hatte das Land in den 70er- und 80er-Jahren total isoliert und abgeschottet. Fast so wie der eingesperrte einsame braune Bär, dem wir im Gebirge auf einer verlassenen Raststätte begegnen. Er soll später für mich zur Allegorie dieses Landes werden; wie er rastlos auf und ab geht und alles frisst, was ihm die wenigen Menschen, die dort vorbei kommen, zuwerfen.

Totenkreuze pflastern den Weg
Als es weiter über die Kämme nordöstlich ins Landesinnere geht, setzt die Abenddämmerung ein und mit ihr die Sorge bei mir, ob wir in der Finsternis unversehrt durch die Berge kommen. Zum Glück schlafen die Kinder betäubt vom Mittel gegen Übelkeit, so dass ich mich ganz aufs Fahren konzentrieren kann. Es sollte die kürzeste Route, ca. 330 km, zu dem Apartment in Mazedonien sein. Wir haben dazugelernt und diesmal reserviert.
Den Rand der engen Bergpässe säumen auffällig viele Grabkerzen. Mini-Altare und Totenkreuze, manche mit Fotos von Verunglückten, mahnen zur Vorsicht. Schon unter den osmanischen Besatzern galt die Gegend als schwer kontrollierbares Territorium, auch heute gibt es hier keine Straßenbeleuchtung, teilweise keinen Straßenbelag und keine Leitblanken.
Endlich. Mit Einbruch der Dunkelheit kommen wir im Tal an, das zur Grenze nach Mazedonien führt. Dieser Grenzübergang ist menschenleer. Der Beamte, überrascht uns zu sehen, wirft einen kurzen Blick in die Pässe und winkt uns freundlich durch.
Erster Muezzin in Mazedonien
Nach zwei Stunden erreichen wir das Apartment in Ohrid. Mein Ohr vernimmt den Gebetsruf des ersten Muezzins unserer Reise. Während der zwei Tage dort fällt auf, dass auf den Straßen Türkisch gesprochen wird; von Touristen aus der Türkei, so wie von einheimischen Türkischstämmigen, die in Mazedonien die drittgrößte Bevölkerungsgruppe bilden. Ohrid liegt am gleichnamigen großen, klaren See und ist eine halbe Stunde vom Geburtsort des Vaters von Atatürk entfernt, dem Gründer der heutigen Türkischen Republik.

Das Dorf Kodjadjik, das heute noch so heißt, ist auch der Geburtsort meines Großvaters väterlicherseits. Ich bin zum ersten Mal hier.
Nach zwei Tagen Sightseeing sitzen wir im Auto Richtung Griechenland und wollen schnell wieder ans Meer. Als Türkischstämmiger wächst man ja in dem Glauben auf, das Griechen nicht unbedingt deine besten Freunde sind. Ähnliches könnte man wohl auch über das aktuelle deutsch-griechische Verhältnis sagen.
„Hallo, ich bin auch Grieche!“
Kurz hinter Thessaloniki checken wir auf dem verschlafenen Zeltplatz von Asprovalta ein. Für 19 Euro die Nacht bekommt man zwar keine exklusiven Sanitäranlagen, aber dafür dürfen wir die unbezahlbare Gastfreundschaft einer griechischen Familie kennenlernen. Sie empfängt uns wie gute alte Freunde und widerlegt alle meine Befürchtungen und Vorurteile.
Es mag vielleicht auch daran liegen, dass ich auf gewisse Weise mit dem Vater der Familie verbunden bin: Stathis Oma stammt gebürtig aus Maltepe in Istanbul, sie lebte dort in etlichen Generationen als orthodoxe Christin. Nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches zog sie nach Thessaloniki, dorthin wo mein Großvater mütterlicherseits geboren wurde, der wiederum Richtung Osten nach Tekirdağ emigrierte.

Es ist erstaunlich, wie viel uns verbindet, und zugleich auch trennt. Plötzlich erscheint mir die Türkei und ihre Verworrenheit mit Europa in einem anderen, plastischen Licht. Für einen Moment fühle ich mich wie einer dieser Typen, die mittags in einem Berliner Club unter Einfluss von Ecstasy im Überschwang der Gefühle alle umarmen möchten, die ihnen begegnen. „Hallo!“, möchte ich jedem Einheimischen zujauchzen: „Ich bin auch Grieche!“ Vielleicht ist es aber auch eine Nebenwirkung vom Tsipouro, dem Anisschnaps, zu dem mich Stathis schon mittags einlädt.
„… etwas Angst vor der Türkei“
In fast zwei Wochen haben wir uns 268 Kilometer an die türkische Grenze vorgearbeitet. Nach einer anrührenden Abschiedsszene mit unseren griechischen Brüdern und Schwestern begeben wir uns auf den letzten Teil unserer Hinreise – in die Türkei.
Als wir am frühen Abend den Grenzübergang Ipsala erreichen, kaufe ich im Duty-free-Shop – so wie es mein Vater auch immer tat – eine Stange Marlboro als Mitbringsel für die türkische crowd. Zugegeben, sehr einfallsreich ist es nicht, aber es ist auch etwas ironisch gemeint, dass nach 26 Jahren wieder jemand mit dem Auto aus der Fremde kommt, den Wagen gefüllt mit Frau und Kindern und einer Stange Zigaretten.
Um noch mal sicher zu gehen, frage ich den jungen Kassierer, ob dies der griechische Duty-free sei. Er bestätigt, also schlussfolgere ich : „Ihr seid Griechen.“ – „Ja“, sagte er, „wir leben in Alexandroupoli.“ – „Fahrt ihr auch mal in die Türkei, wenn ihr schon direkt an der Grenze wohnt?“ Der junge Mann schreckt etwas zurück, gesteht zögerlich: „Nein, wir waren noch nie in der Türkei …“ – „Warum?“, frage ich erstaunt. „Wir haben etwas Angst davor“, sagt er leise. Ich weiß nicht was ich darauf sagen soll, nehme den Kassenbon, die Zigaretten und steige ins Auto – und dann war es wieder da: das mulmige Gefühl.
Der Weg zwischen türkischen und griechischen Grenzübergang, im sogenannten „No Man’s Land“, ist zwischen diesen beiden Ländern bisher der längste, und er wird von mehreren bewaffneten türkischen Soldaten bewacht. Je weiter wir uns dem Grenzübergang nähern, umso stärker spüren wir, dass wir gleich ein großes, nervöses Land betreten.
Fortsetzung folgt…
Text: Atilla Oener