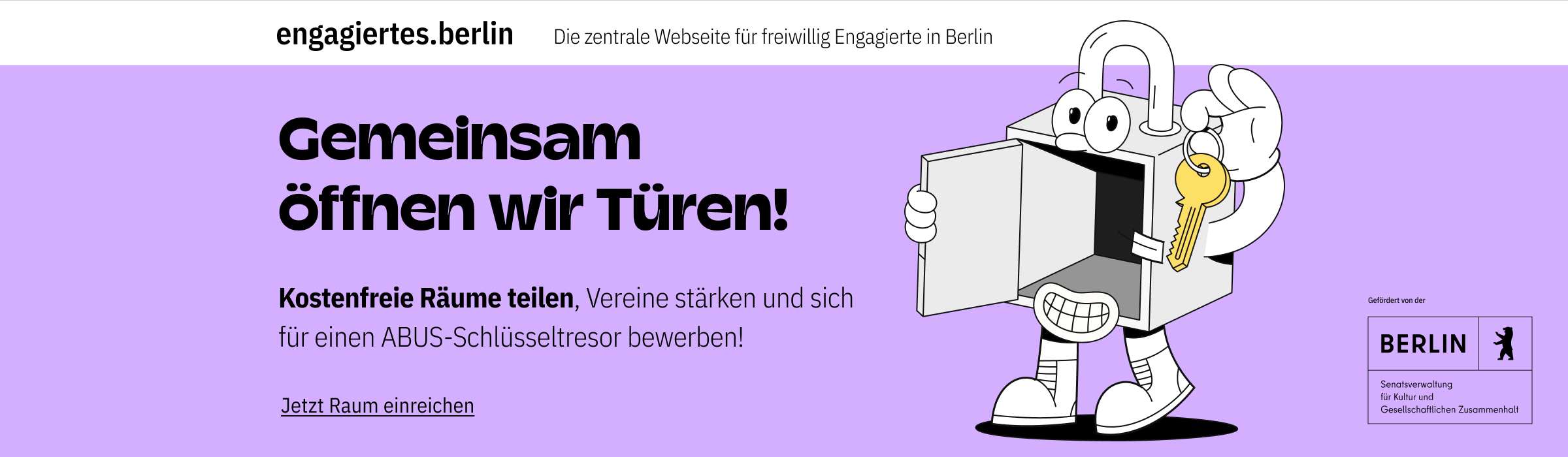Besonders muslimisch sichtbare und gelesene Frauen stehen immer wieder im Fokus von Politik und Medien. Die Journalistin Nour Khelifi beschreibt die endlosen Diskussion rund um ihr Aussehen und warum das Fehlen von einem Stück Stoff die Eintrittskarte schlechthin zu Erfolg und Akzeptanz in der Gesellschaft sein sollte.
Schon als Kind habe ich mit meinen Eltern immer sonntags die Zeitung gelesen. Angefangen von den klassischen Boulevardblättern bis hin zu renommierten Tages-und Wochenzeitungen. Durch Artikel, Kolumnen über korrupte Politiker und die High Society Österreichs habe ich gestöbert und mir immer wieder dieselbe Frage gestellt: wer sind die Menschen hinter diesen abgedruckten Worten und wie klettert man diese Karriereleiter hoch? Ich war um die 10 und fragte mich nicht nur, wie man Journalist:in wird, sondern auch, wie ich eine werden kann. Aber warum sollte ausgerechnet eine 10-Jährige in diese Richtung denken?
Schon als Kind spürte ich, welche Hürden es gibt und dass ich nicht so betrachtet werde wie eine Karin, Peter oder Carmen. Das ständige Nachfragen, ob ich gut deutsch verstehe, ob ich es sprechen kann, woher ich denn nun wirklich komme. Und Immer wieder habe ich mich während meiner Schullaufbahn gefragt, warum Erwachsene mit mir oder anderen migrantischen Kindern so komisch reden. Als ob wir erwachsene Menschen wären und keine Kinder. Während andere Kinder sein durften und auch so behandelt wurden, wurden wir mit anderen Maßstäben gemessen. Das wurde mir und meinen Geschwistern schon zuhause eingetrichtert, dass wir nicht nur gute Noten brauchen, sondern herausragende. Dass wir nicht nur gutes, sondern einwandfreies Deutsch reden müssen. Sie wussten, dass die Gesellschaft uns ganz besonders an unseren Leistungen messen wird, weswegen sie viel mehr Wert auf Deutsch legten, als Arabisch.
Jahrelang hat sich das in meinem Kopf die Vorstellung manifestiert, dass der Beruf der Journalistin etwas Unerreichbares für mich ist. Journalist:innen können nur weiße Menschen werden, davon war ich überzeugt. Am besten reich, mit Kontakten zur Politik oder noch besser mit Verwandten aus der Politik, so richtig elitär. Jeden Sonntag, wenn ich die Zeitungen aufgeschlagen und die deutschen Namen der Autor:innen gelesen habe, fühlte ich mich bestätigt, dass Menschen wie ich da nicht willkommen sind, wenn weit und breit keine Spur von ihnen zu sehen oder lesen ist. Deshalb wundert es mich heute umso mehr, dass ich dennoch meinen Weg in den Journalismus gefunden habe, als muslimisch sichtbare Woman of Colour. Immer noch mit dem Mindset, dass ich dort nichts verloren habe und es auch nicht weit bringen werde. Die Medienbubble, in die ich durch Umwege hineingeraten bin, war genauso, wie ich sie mir als 10-Jährige vorgestellt habe: überwiegend deutsch klingende Namen. Diversität war mittlerweile auch da in der Medienlandschaft, aber man musste schon aktiv nach ihr suchen, um sie zu finden.
Die „Ausländerkinder“
Auch wenn das jetzt so abwegig klingt: In meiner Jugend gab es Begrifflichkeiten wie Repräsentation von Minderheiten und Diversität tatsächlich noch nicht. Von Intersektionalität oder Feminismus ganz zu schweigen. Das Einzige, das mich und meine Freund:innen damals einte, war unser „Ausländer“-Dasein, denn wir waren immer und überall „die Ausländer“. Wir sind alle in Österreich geboren, aufgewachsen, sozialisiert worden, haben die österreichische Staatsbürgerschaft. Aber trotzdem den Stempel „Ausländerkind“ bekommen. Ich war erst im Kindergartenalter, als ich zum ersten Mal gesehen, gespürt und erlebt habe, dass ich „anders“ bin als der Rest. Meine Eltern sind in ihrer Studienzeit von Tunesien nach Österreich gezogen, trotzdem stets mit antimuslimischen Rassismus und Diskriminierung konfrontiert, weil Rassismus nun mal auch intersektional ist und keine Klasse kennt – diskriminiert wird, wer nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehört und als anders markiert wird.
Irgendwann in meiner Jugend habe ich mich für das Kopftuchtragen entschieden. Meine Mutter meinte, ich soll tun, was ich will. Mein Vater war dagegen, wusste, was das für mich langfristig bedeuten würde, nämlich Probleme in der Schule, im Studium, am Arbeitsplatz und draußen auf der Straße. Ich war ein Teenager und dachte, ich wüsste alles besser, mir wird schon nichts passieren. Und mir ist auch jahrelang in der Tat nichts passiert. In meiner kompletten Schullaufbahn auf dem Gymnasium wurde ich genau zweimal gefragt, wieso ich es trage. Aber antimuslimischen Rassismus oder dergleichen habe ich Gott sei Dank nie erfahren, weder von Mitschüler:innen noch von der Lehrer:innenschaft. Vielleicht hatte es auch damit zu tun, dass meine Mutter an derselben Schule unterrichtet hatte, an der Stelle kann ich nur spekulieren. Aber ich weiß, dass ich ein Einhorn bin, was meine diskriminierungsarme Schulzeit betrifft. Ich spreche hier gezielt von diskriminierungsarm, weil diskriminierungsfrei war es nie und wird der Alltag von marginalisierten Menschen vielleicht auch nie sein. Die rassistischen und sexistischen Alltagssituationen kamen erst nach dem Abitur. Ich würde schöner ohne Kopftuch aussehen, wieso ich meine Haare verstecke, ob mein Vater mich zwingt, wieso ich ein Nonnenleben führen möchte, ob ich den keinen Freund will. Komischerweise hatten alle Argumente immer was mit Partnern, Sexualität und eben meinen Körper zu tun.
Kein schlechter Witz
Frisch auf dem Gymnasium angekommen, unter vielen neuen Gesichtern und Lehrer:innen, wurde ich gleich mit den obligatorischen Fragen seitens der Kinder konfrontiert, was meine Eltern denn beruflich so machen. In meiner kindlichen Naivität habe ich auf diese Frage mit
„Meine Mutter arbeitet hier an der Schule“ geantwortet.
Wie ich später erfuhr, sind daraufhin einige Kinder davon ausgegangen, dass meine Mutter „Putzfrau“ sei. Denn mit meinem Namen und meinem Background konnten sie sich wohl nicht vorstellen, dass meine Eltern auch Lehrer:innen hätten sein können. Heute kann man so etwas als internalisierten Rassismus bezeichnen.
Auch fanden die Lehrer:innen es – euphemistisch ausgedrückt – „außergewöhnlich“, dass meine Mutter ihren Nachnamen behalten hatte, anstatt den meines Vaters anzunehmen. Diese Diskussion wurde erst recht auf ein neues Level in meinem Umfeld gehoben, nachdem ich vor zwei Jahren einen weißen, deutschen Mann geheiratet hatte. Ich würde es als Nour-El-Houda Aleksander leichter haben bei den Behörden, auf der Wohnungssuche und vor allem im Job als Journalistin, wenn ich seinen deutschen Nachnamen angenommen hätte, sagten die meisten Freund:innen und Kolleg:innen. Nour-El-Houda Aleksander – der Name klingt wie aus einer Spam-Mail, in der einem hunderttausend Dollar aus einem vermeintlichen Nachlass angeboten werden. Die meisten Menschen akzeptieren mich in der Gesellschaft nicht als Frau, die ein Kopftuch trägt. Da wird ein deutsch oder österreichisch klingender Name nicht dieses antifeministische Problem beheben. Weder in Österreich noch in Deutschland würde man den Namen Aleksander mit meinem Aussehen einfach so als Fakt annehmen. Sowas würde nur für noch mehr Verwirrung, aber auch Neugier und vielleicht Skepsis sorgen. Dann bleibe ich lieber bei Nour-El-Houda Khelifi mit den Ausweiskontrollen und erspare mir das lange Gerede. Dieses Muster zieht sich generell durch mein ganzes Leben, dass ich es hier und da „einfacher“ und „besser“ hätte, wenn ich etwas an meiner Identität und meiner Persönlichkeit ändern würde. Ich bin dennoch davon überzeugt, dass bestimmte Situationen in meinem Alltag weiter bestehen würden. Mit so einem Namen wie meinem bekommt man viele unangenehme Extrawürste an zufälligen Ausweiskontrollen, Leibesvisitationen, Wischtests auf Sprengstoff beim Securitycheck am Flughafen und die Frage, ob man Deutsch spricht oder versteht.
Ich bin auch hier
Ich war 21, als ich anfing, langsam aufzuwachen. Journalistisch schon viel erreicht, für viele Journalist:innenpreise nominiert, manche auch gewonnen, sogar als eine der „30 besten Journalisten unter 30„ in Österreich gekürt worden. Aber trotzdem habe ich nie zu dieser hiesigen Journalist:innenbubble dazugehört. Ich wurde nicht auf Events oder Get to together-Abende eingeladen. Ich habe keine Twitter-Lobeshymnen von anderen Kolleg:innen erfahren, kein Networking, Smalltalk, Festanstellungen oder sonstige Bemühungen, mich als Kollegin öffentlich wahrzunehmen oder zu akzeptieren. Lag es am Kopftuch? An meiner Herkunft? Dass ich nicht jeden Abend mit Kolleg:innen etwas trinken gegangen bin? Obwohl ich eine von ihnen bin, war ich dennoch eine Beobachterin der Bubble. Dazugehören, das durften und konnten nur die anderen, die der Mehrheitsgesellschaft anhören und nicht aus dem Raster fallen. Marginalisierte Menschen wie ich träumen davon, Chefredaktionsposten einzunehmen oder Verantwortungsbereiche zugeteilt bekommen, die nun mal nicht ausschließlich nur in der Diversity-Nische vorhanden sind. Die berühmte gläserne Decke war in meinem Fall aus Beton. Meine Arbeit war nicht weniger gut als die meiner Kolleg:innen, trotzdem habe ich nicht die gleichen Möglichkeiten erhalten. Inhaltlich und qualitativ bewegten wir uns nahezu alle auf demselben Terrain. Trotzdem begegnete man mir anders, weil immer wieder meine Objektivität in Frage gestellt wurde aufgrund meines Aussehens. Was mein Weltbild war, glaubten Menschen direkt an meinem Kopftuch interpretieren zu können, anstatt mich als Person selbst erklären zu können.
„Ich bin am Rassismus schuld“
Eine Kollegin hat mich eines Tages zu ihr nachhause zum Essen eingeladen, was mich sehr überrascht hat und laut anderen Kolleg:innen eine Riesenehre war, weil nicht jede:r im Büro so eine Einladung bekommt. Sie war bekannt für ihre phänomenalen Kochkünste. Zum ersten Mal habe ich mich im Arbeitskontext privilegiert gefühlt. Sehe ich da etwa Risse in der Betondecke? Im Laufe des Abends und nach handgemachten Dumplings, sind wir auf das Thema „Rassismus und Diskriminierung im Alltag“ gekommen. Monatelang habe ich neben dieser Frau gearbeitet, kein einziges Mal haben wir dieses Thema angesprochen. Wie es mir als Frau mit Kopftuch ergeht, wollte sie wissen. Irgendwann meinte sie, dass ich es doch einfacher hätte, wenn ich das Kopftuch ablegen würde. Ich wusste, worauf sie hinauswollte, aber selbst ohne Kopftuch wäre ich nicht der Überzeugung, dass ich die Karriereleiter nach oben klettern könnte ohne jegliche Hürden. Die Journalist:innenbubble hat verschiedene Sektoren, von rechtskonservativ über links bis hin woke ist alles dabei. Aber wenn Menschen erfahren, dass du eine praktizierende Muslimin bist, stehen sie dir anders gegenüber als vorher. Was auch wiederum zeigt, dass insbesondere eine Bubble an linken Journalist:innen eigene antimuslimisch-rassistische Ressentiments hinterfragen muss.
Dieser Abend hat mir die Augen geöffnet, weil ich zwischen den Zeilen verstanden hatte, dass ich es immer nur bis zu einem gewissen Level schaffen werde, weiter aber nicht. Das hat nicht vorrangig etwas mit der Medienbranche zu tun. Alleine wenn man sich vorstellt, was das für eine Tragkraft hat, wenn ein Mensch mit Behinderung oder eine schwarze Person aufgrund des Berufsposten so sichtbar ist, dass unterbewusst ein Umdenken in der Gesellschaft stattfindet. Denn Sichtbarkeit bedeutet auch letzten Endes Hoffnung und hat die Macht, uns träumen zu lassen. Mir wurde zu verstehen gegeben, dass ich nie Chefredakteurin oder Nachrichtenmoderatorin sein könnte. Weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Was soll das für eine Message sein? Dass man den „Kampf gegen den Islamismus“ verloren hat, weil eine Frau mit Kopftuch jetzt sichtbar und beruflich aufgestiegen ist? Ich war enttäuscht, traurig, aber vor allem wütend. Wieso muss ich mich ändern, wieso muss ich mein Aussehen verändern, um angenommen zu werden? Wieso kann sich die Gesellschaft nicht ändern? Wieso müssen sich Menschen, die nicht der Mehrheitsgesellschaft entsprechen, dermaßen umformen, damit sie akzeptiert werden? Trotz alledem dachte ich mir: jetzt erst recht. Ich werde es allen zeigen. Ich war jung, naiv, voller Energie, auf der Suche nach Anerkennung. Es aber es zehrte ungemein an den eigenen Energiereserven, weil ich in Bereiche vorgedrungen bin, in denen ich lange alleine dagestanden bin, keine Mentor:innen oder Allies in Sicht, keine Menschen, mit denen ich mich kollektiv verbunden fühlte aufgrund der gemeinsamen Geschichte.
Diese Wut spüre ich mit meinen 27 Jahren immer noch. Wütend, weil ich nicht weiß, was ich noch tun muss oder tun kann, um endlich so akzeptiert zu werden, wie ich bin, ohne dass ein Riesenschauspiel von gewissen Akteur:innen aus der Medienbranche daraus gemacht wird. Selbst wenn ich das Kopftuch ablege, bleiben immer noch mein Name und mein Aussehen, Beides entspricht nicht dem, was in einer von Weißen dominierten Gesellschaft erwartet und akzeptiert wird. Genauso verhält es sich mit Hautfarbe oder Sexualität, kann man nicht ablegen und gehört zu einer Person und ihrer Identität dazu.
Gekommen um zu bleiben
Immer noch wird mir bis heute unterstellt, dass ich mir mein Leben und meine Karriere selbst unnötig erschwere, weil ich am Kopftuch festhalte. Keine Beleidigungen, keine Angriffe, keine Blicke, wenn ich mich endlich richtig entscheiden würde und das Kopftuch ablege. Als ob ich mit meinem Kopftuch schuld daran wäre, dass ich sexistisch und antimuslimisch-rassistisch angefeindet werde, egal ob auf der Straße oder in sozialen Medien. Und was kommt dann als Nächstes? Meine Haare konstant färben, kosmetische Eingriffe am Gesicht, Namen umändern, zu einer anderen Religion konvertieren, einfach ein komplett neuer und anderer Mensch werden? Wer bin ich dann, wenn ich mich Nora Aleksander nenne und mich im Spiegel nicht mehr wieder erkennen kann? Wo hören diese Schritte auf, die angeblich das Leben vereinfachen? Es sollte jeden wütend machen, denn ich dachte jahrelang, dass jeder Mensch frei über sich selbst, das eigene Leben und den eigenen Körper verfügen darf. Was ich als junge Frau aber erlebe, ist, dass nur gewissen Teilen der Gesellschaft dieses Privileg offen steht. Manchmal jedoch weicht die Wut der Ohnmacht. Ohnmächtig, weil ich mich allein fühle in einem Kosmos, in dem Menschen wie ich nicht sichtbar sind und nicht sichtbar gemacht werden. An anderen Tagen wiederum flackern ein bisschen Optimismus und Hoffnung auf, weil es dann doch Kolleg:innen gibt, die zur Sichtbarkeit beitragen oder mich und meine journalistische Expertise schätzen.
Mit 19 im Journalismus angefangen, mit 27 Jahren immer noch als Journalistin tätig. All die Jahre, habe ich mich gefragt, ob ich in dieser Branche bleiben kann, ja bleiben darf. Ob mir in anderen Berufsfeldern dieselben Probleme begegnen würden? Wahrscheinlich schon. Der ständige Erwartungsdruck von anderen, egal, welchen Karriereweg ich einschlage, aber auch Druck, den ich mir selbst aufbaue. Angst zu scheitern. Angst, weil ich in den meisten Spaces die erste „meiner Art“ war. Angst, etwas falsch zu machen oder zu sagen, das auf alle sichtbaren muslimischen Frauen projiziert wird. Das Einzige, das ich jemals wollte und immer noch will, ist einfach nur, ein Individuum zu sein, nur für mich selbst zu stehen und für mich selbst zu sprechen, anstatt immer als etwas homogenes betrachtet zu werden. Egal in welcher Branche ich arbeite, ich möchte Fehler machen dürfen, die nur mir allein zugeschrieben werden und nicht einer Gruppe, der ich angehöre, ich möchte Chancen bekommen und einfach ich sein, ohne etwas an mir ändern zu müssen, damit andere mich akzeptieren.
Insgeheim wünschen wir uns das doch alle, nicht wahr? Ich will nur für mich stehen, nur für mich reden und nicht das Sprachrohr für Millionen muslimische Frauen und Menschen weltweit sein. Ich muss anderen Menschen keine Stimme geben, denn das würde implizieren, dass sie selbst keine haben. Diese Menschen, mich dazugezählt, möchten nur eine Gelegenheit, einen Raum, eine Plattform bekommen, um unsere Stimme erklingen zu lassen. Wir wollen nämlich sichtbar sein. Wir wollen gehört werden. Wir wollen sein, so wie wir sind.
Text: Nour-El-Houda Khelifi (she/her)
arbeitet als Journalistin & Drehbuchautorin in Berlin & Wien. Die Grimme-Preisträgerin arbeitet u.a für den ORF & funk (ARD/ZDF), beschäftigt sich mit deutsch-österr. Politik & Diversität. 2017 bis 2020 war sie Headautorin des Satireformats „Datteltäter“.