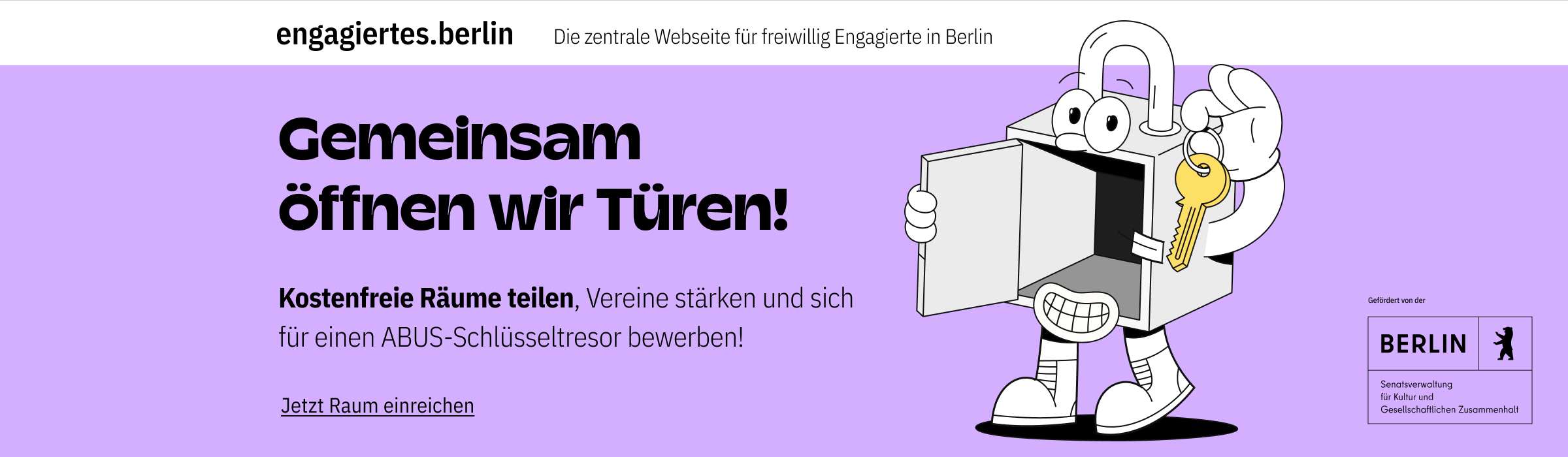Tokio. Eine Stadt, die voller Gegensätze ist: Modern und traditionell, laut und leise, hell und dunkel, geordnet und chaotisch, deutsch und türkisch. Zumindest, wenn man will! Ich bin nun zum zweiten Mal hier und je mehr ich darüber nachdenke, desto stärker glaube ich, dass man dort, wo man aufgewachsen ist, den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Insbesondere als, wie man politisch korrekt sagt, Deutscher mit türkischem Migrationshintergrund, der gar nicht weiß, wohin er gehört. Die berühmte Identitätsfrage. Ein Konflikt, den vermutlich die meisten Menschen aus einer Zuwandererfamilie kennen.

Atatürk in Kushimoto
Graue Hochhäuser, grüne, blaue, gelbe, weiße Lichter der Werbetafeln und Autos und Musik. Türkische Musik. Popmusik der, wenn ich mich recht erinnere, 90er oder frühen 2000er. Es stehen zwei Männer auf dem Weg, die für ihre Lokale werben und laut und etwas aufdringlich „Welcome, welcome, buyrun!“ rufen. Ich muss grinsen und antworte „Kolay gelsin!“ (dt. „Frohes Schaffen!“). An einem anderen Tag betrete ich das Gebäude des Goethe Instituts.
Es ist ganz ruhig, ab und zu laufen Angestellte an mir vorbei und begrüßen mich mit „Hallo“ und „Guten Tag“. Ich erwidere ihre Begrüßung und sehe ein Café im Foyer des Gebäudes, das unterschiedliche, mir vertraute Biersorten anbietet. Vor der Tür ist ein Schild aufgestellt, auf dem steht: „Frische Brezel“. Ich muss grinsen. Beides sind Situationen aus meinem Leben in Tokio. Ein bisschen türkisch, ein bisschen deutsch. Weder das eine noch das andere ist fremd.

Vielleicht zieht es mich deshalb immer wieder hierher. Nicht nur haben Deutschland und Japan eine sehr gute wirtschaftliche und kulturelle Beziehung zueinander, auch die türkisch-japanische Beziehung ist erwähnenswert. Es gibt eine grammatikalische Gemeinsamkeit der türkischen und japanischen Sprache und Japaner sehen die Türkei als must-see-Reiseziel! Außerdem steht in der japanischen Stadt Kushimoto eine Statue des türkischen Staatsgründers Atatürk, die an die gemeinsame Geschichte erinnert, die 2015 sogar verfilmt wurde (türk. Ertuğul 1890; engl. 125 Years Memory).
Ein „richtiger“ Ausländer sein
Vielleicht, weil ich weiß, dass ich hier ein „richtiger” Ausländer bin. Nicht wie in Deutschland, wo ich mal als Bürger, ein andermal aus Ausländer bezeichnet werde. Und auch nicht wie in der Türkei, wo ich nicht als vollwertiger Türke, sondern als „Deutscher” bzw. „Alamancı” in eine Schublade gesteckt werde. „Und? Wie stehst du zu Erdogan?” ist in Deutschland wie eine Fangfrage. In diese Situation komme ich hier in Japan erst gar nicht.
Bei den sogenannten „Internationals” – Tokio ist eine ziemlich internationale Stadt mit „ausländischen Ausländern” und Japanern, die in einem anderen Land groß geworden sind oder gelebt haben – bin ich einer von den Ausländern, der in dieser internationalen Community fußgefasst hat.
Der Typ aus Deutschland, der türkische Wurzeln hat und jetzt in Japan ist.
Bei den “japanischen Japanern” – wow, ich kritisiere hier das Schubladendenken und mir fällt keine passendere Umschreibung für diese Personen ein – bin ich einfach ein Ausländer, oder wie es so schön auf Japanisch heißt: ein „Gaijin” (zu Deutsch wortwörtlich „Mensch von außen“). In beiden Fällen muss ich (meistens) nicht beweisen, dass ich sehr wohl Deutsch und Türkisch kann (oder nicht kann, wenn es so wäre).

Mein deutsch-türkisches Deutschland
Vielleicht zieht es mich auch hier hin, weil ich auch hier deutsch-türkische Dinge tun kann, die in Deutschland völlig normal sind. Im ersten Moment vermutlich nichts Erwähnenswertes, aber hier im Land der aufgehenden Sonne für mich doch ein bisschen besonders: Der morgendliche Döner nach dem Feiern (okay, bei mir ist es doch eher ein Falafel-Wrap) gehört hier nach einer Partynacht einfach dazu. Im Hintergrund läuft türkische Musik und das „Afiyet Olsun” von der anderen Seite der Theke erinnert mich sehr an Deutschland.
Vielleicht bin ich aber auch gerne hier, um Heimweh auf meine eigene Art zu erleben. „Heimweh“. Das hatten einige meiner Mitstudierenden aus Deutschland, als ich im Jahr 2015 das erste Mal nach Tokio kam. Sie erzählten von „typisch deutschen Dingen“, die sie vermissen: Deutsches Brot, deutsche Kirchenglocken, deutsches Bier oder die deutsche Mentalität, was auch immer das bedeutet.
Obwohl ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin, habe ich andere Dinge vermisst: Das türkische all-you-can-eat-Frühstück, die türkische Gastfreundschaft und der Besuch bei türkischen Familien mit Çay und einem Stück Bienenstich sowie die türkische Sprache, die ich normalerweise täglich, meistens unbewusst und unbeabsichtigt, mit deutschen Wörtern ausschmücke. Mir wichtige Dinge, die zu meinem Deutschland dazugehören.

Integration mal anders
Heute geht es mir ähnlich wie damals. Ich lebe in Tokio, einer Stadt, die für mich mittlerweile weniger Ausland ist als das Dorf meiner Großeltern in Anatolien. Trotzdem bekomme ich ein Gefühl der Vertrautheit, wenn ich Sänger*innen höre, die, untermalt von langsamen orientalisch angehauchten Saz-, Gitarren- und Klarinettenklängen, über ihre zertrümmerte Liebe und ihr brennendes Innere singen. Wenn ich laute, unkomplizierte, gesellige und offensive Menschen treffe, denen es nicht peinlich ist, zu jeglicher Art von Musik zu tanzen, ohne unter Alkoholeinfluss zu stehen.
Dinge, die sich als Ausgleich zur Ordnung, dem Gewissenhaftsein und dem Fleiß im Alltag entpuppt haben. Dinge, die auch zu meinem Deutschland dazugehören. Deutsche und türkische Dinge, die mich als Kind und Jugendlicher genervt haben, weil ich das Gefühl hatte, sie können nicht zusammen stattfinden und ich müsse mich entscheiden. Jetzt bin ich knapp 10.000 Kilometer von „zu Hause“ entfernt und versuche all diese Dinge in meinen Alltag zu integrieren.
Text: Tolga Sert
Illustration: Yasmin Anılgan
Empfehlung der Redaktion: Film „Ertuğrul 1890“