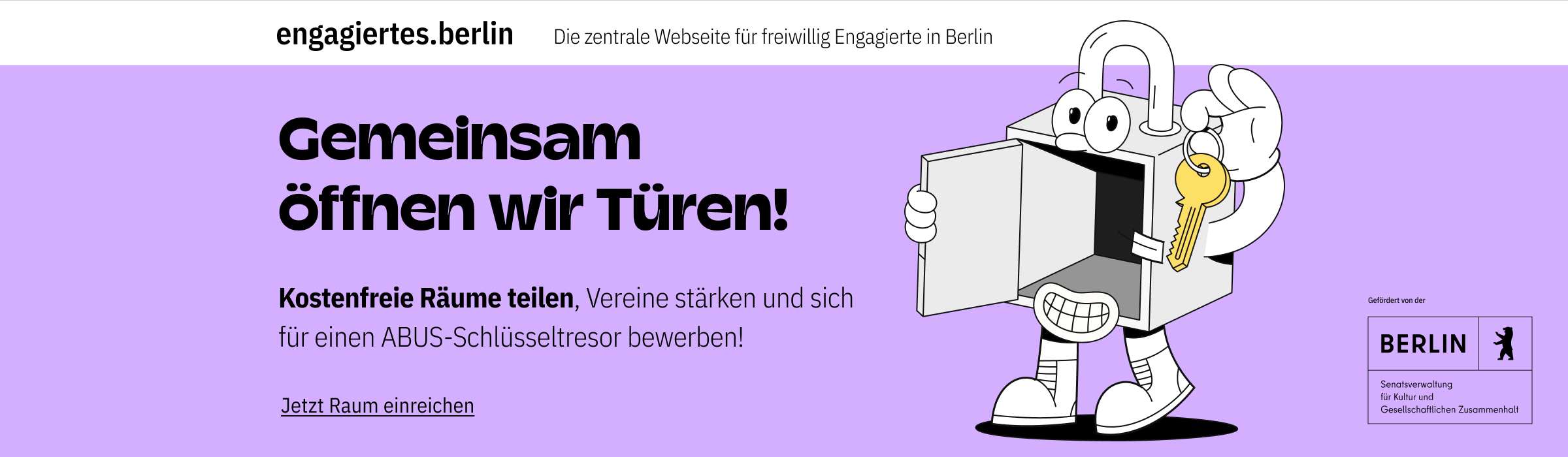Rassismus, wie wir ihn heute kennen, kann also wie folgt definiert werden: Rassismus konstruiert Rassen, sodass körperliche, kulturelle oder religiöse Aspekte als genuine Gruppenmerkmale erscheinen, die für alle Gruppenmitglieder zentral bedeutsam seien und einen grundsätzlichen Unterschied zur ‚eigenen‘ Gruppe markierten. Die Konstruktion von ‚Rassen‘ hat zum Ziel und/oder als Effekt, dass eine eigene Gruppenidentität durch Abgrenzung von Anderen geschaffen wird und dass Aggressionen, Ausschlüsse und Privilegien damit legitimiert werden.
Das bedeutet: ‚Rassen‘ sind ein Produkt des Rassismus und nicht umgekehrt. In anderen Worten: Es gab und gibt keine ‚Rassen‘, Rassismus erzeugt sie.
Erst im Zuge der Rassifizierung (dem Prozess der Rassenkonstruktion) werden vermeintliche oder tatsächliche Unterschiede zwischen Menschen zu rassistischen Differenzen gemacht. Historisch ist der ‚Rassen’diskurs eng mit der Vertreibung von Jüd_innen und Muslim_innen aus Europa sowie der Versklavung und Kolonisierung der indigenen Bevölkerungen Amerikas, Afrikas und Asiens verknüpft. Der religiös-kulturell begründete Rassismus des 15./16. Jahrhunderts mündete in der Erfindung der ‚Reinheit des Blutes‘ (Hering Torres 2006) und ihrer Setzung als Grundlage von Gemeinschaft. Nach 800-jährigem Zusammenleben von jüdischen, muslimischen und christlichen Gemeinschaften unter arabisch-amazighisch-muslimischer Herrschaft auf der Iberischen Halbinsel beendete die spanisch-katholische Herrschaft die gesellschaftliche Pluralität.
Sie zwang zunächst die muslimische und jüdische Bevölkerung zu konvertieren und sich kulturell zu assimilieren. Später wurden die (zwangs-)konvertierten ‚Conversos‘ (ehemalige Jüd_innen) und ‚Moriscos‘ (ehemalige Muslim_innen) vertrieben und deportiert. Krone und Kirche meinten, nationale Einheit nur über religiös-kulturelle Reinheit erreichen zu können (Soyer 2012). Die derart in den Mittelpunkt gestellte Differenz zwischen Bevölkerungsgruppen, die Jahrhunderte lang miteinander gelebt hatten, wurde zwar als religiöse mit kultureller Bedeutung bezeichnet, aber als natürliche behandelt. Anwärter für angesehene Berufe und Positionen mussten etwa nachweisen, dass ihr Blut ‚rein‘ ist. Das bedeutet, sie durften über keinerlei jüdische oder muslimische Vorfahr_innen verfügen. Dieser Nachweis war auch dann zu erbringen, wenn keinerlei Unterschiede zwischen den Anwärtern und ihren christlichen Mitbewerbern bestand, sie sich also weder durch religiöse oder kulturelle noch durch körperliche oder andere sichtbare Merkmale unterschieden.
Zur gleichen Zeit bildete der koloniale Rassismus das diskursive Grundgerüst, um ökonomische Ausbeutung sowie politische und soziale Ungleichheit in den von Europa beanspruchten Kolonien und in den Kernländern der Imperialmächte selbst zu begründen. Im Unterschied zu Jüd_innen und Muslim_innen, die die ‚falsche‘ Religion und damit auch Kultur hatten, galten die kolonisierten Bevölkerungen Amerikas und später auch Afrikas als gänzlich religionslos. Damit stand ihr Mensch-Sein grundsätzlich infrage (Wallerstein 2007). Die Invasion, Ausbeutung, Vertreibung und Vernichtung von Menschen ging mit dem Versuch einher, sie zu missionieren und zu zivilisieren. So unterschiedlich die Umgangsweisen waren, ihnen allen lag die Vorstellung zugrunde, dass die Christ_innen berechtigt, ja sogar verpflichtet seien, andere auch gegen ihren Willen und Widerstand zu ‚zivilisieren‘, sprich zu beherrschen. So konnte die Ausbeutung von Menschen und ihren Ressourcen legitimiert werden, selbst Gewalt gegen sie bis zu ihrem Tod wurde damit gerechtfertigt.

Diese historischen Erfahrungen, die symbolisch mit dem Jahr 1492 verbunden sind, dienen auch heute noch als grundlegende Bezüge zur Rassifizierung von Jüd_innen, Muslim_innen, Menschen afrikanischer, asiatischer und amerikanischer Herkunft sowie Sinte_zza und Rom_nja. Religion und Kultur gerieten jedoch im Zuge der Zurückdrängung der politischen Bedeutung des Christentums und dem Erstarken von Aufklärung und Wissenschaften in den Hintergrund. ‚Rasse‘ wurde zunehmend biologisch und genetisch begründet und diente mal mehr und mal weniger offen der Legitimation von Ungleichheit und Gewalt. Zunehmend problematisch wurden offen rassistische Argumentationen angesichts einer sich aufgeklärt und fortschrittlich begreifenden Gesellschaft. Dem Selbstverständnis stand die Wirklichkeit entgegen und benötigte – abermals – einer Rechtfertigung. Dass aber der moderne Rassismus nicht weniger grausam wirken kann, zeigen der Kolonialismus und der Nationalsozialismus eindrücklich: Ein großer Teil der Jüd_innen, Sinte_zza und Rom_nja Europas fiel der genozidalen Politik des Nationalsozialismus zum Opfer. Auch der deutsche Kolonialkrieg im heutigen Namibia zielte auf die Vernichtung der Herero und Nama, nur wenige konnten sich dem Einflussbereich der deutschen Imperialmacht entziehen und ihr Leben retten. Diese Genozide gründeten auf modernen rassistischen Ideologien und wurden offen rassistisch legitimiert. Davor, daneben und danach existier(t)en weitere Formen von Rassismus, die unterschiedlich offen und gewalttätig waren bzw. sind und unterschiedlich aggressiv Ungleichheit herstell(t)en und durchsetz(t)en.
Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird der Begriff der ‚Rasse‘ häufig ersetzt durch den der Ethnie, Kultur oder Religion.
Der Begriff des Rassismus wurde (und wird zuweilen noch) in der Bundesrepublik ersetzt durch jenen der ‚Fremdenfeindlichkeit‘ (Kalpaka/Räthzel 1990). Als ‚fremd‘ gelten dabei jedoch nicht jene Menschen, deren Lebensweisen und Ansichten anderen Menschen fremd sind. Die meisten Menschen sind einander fremd, soziale und kulturelle Unterschiede innerhalb von Gesellschaften sind die Regel. Vielmehr galt die ‚Feindlichkeit‘ (und oft genug auch die ungefragte und übergriffige, als ‚Freundlichkeit‘ daherkommende Einmischung und Grenzüberschreitung) jenen Menschen, die entweder als ‚fremd‘ wahrgenommen wurden (etwa Sinte_zza, Schwarze, jüdische oder muslimische Deutsche) oder zu ‚Fremden‘ gemacht wurden. Zu letzteren zählen etwa eingewanderte Menschen, die einige Jahrzehnte warten mussten, bis sich die deutsche Gesellschaft und Politik durchringen konnten, sie nicht länger als ausländische ‚Gäste‘, sondern als eingewanderte Bürger_innen zu akzeptieren und sich selbst als Einwanderungsgesellschaft zu organisieren. Zu den zu ‚Fremden‘ Gemachten zählen auch jene Menschen, deren Leben und Selbstbild durch die Erfahrung von Rassismus derart geprägt ist, dass sie sich zuweilen tatsächlich als ‚fremd‘ im eigenen Land fühlen. Menschen werden also erst durch Rassifizierung zu Fremden gemacht.
Aktuelle Formen von Rassismus argumentieren im Unterschied zu historischen Formen und im Unterschied zum Rechtsextremismus nicht direkt mit biologischen Unterschieden. Des Rassismus „vorherrschendes Thema [ist] nicht mehr die biologische Vererbung, sondern die Unaufhebbarkeit der kulturellen Differenzen“ (Balibar 1990: 28), der Rassismus argumentiert „differenzialistisch“, es handelt sich um einen „Rassismus ohne Rassen“ (ebd.). Ethnische, kulturelle und religiöse Differenzen werden wie biologische naturalisiert, also „als unveränderliche und vererbbare“ (Rommelspacher 2009: 29) Merkmale verstanden. Gleichzeitig sind die meisten Menschen ambivalent „in rassistische Diskurse verstrickt“ (ebd.: 33): Dem aufgeklärten Selbstbild, Gesellschaftsmodell und Weltkonzept zufolge sind sie überzeugt davon, dass alle Menschen gleichberechtigt und gleich viel wert sind. Ihre faktische Ungleichbehandlung, die mit unterschiedlichen Zugängen zu Ressourcen einhergeht, muss also gerechtfertigt werden. Hierzu wird auf tradierte Rassismen zurückgegriffen, die den aktuellen Verhältnissen angepasst werden. Das unterscheidet Rassismus von Rechtsextremismus, der auf Ungleichwertigkeitsideologien sowie entsprechenden Politikkonzepten und Gesellschaftsvisionen beruht und diese verteidigt, während Rassismus jenseits extrem rechter Gruppierungen weder offen verteidigt wird noch intendiert sein muss.
Beim Antisemitismus, Rassismus gegen Sinte_zza und Rom_nja (Antiziganismus bzw. Antiromaismus), antischwarzen Rassismus und antimuslimischen Rassismus handelt es sich um jeweils historisch spezifische Rassismen, die bestimmte Funktionen erfüllen. Dennoch sind die Rassismen miteinander verwoben. Sie beziehen sich aufeinander, weisen strukturell die gleichen Mechanismen auf, können auf ähnliche Diskurse zurückgreifen, Parallelen und Unterschiede aufweisen, spezifische Funktionen erfüllen. Sie vereint ein Rassifizierungsprozess, der über bloße Vorurteile oder Stereotypisierungen hinaus geht, mit der Etablierung und Verteidigung gesellschaftlicher Machtverhältnisse einhergeht und auf diese Weise Privilegien und den Zugang zu Ressourcen reguliert: Mit Hinweis auf ihre ‚Rasse‘, Ethnie, Kultur und/oder Religion werden Menschen zu Gruppen zusammengefasst und in einem Konstruktionsprozess homogenisiert, essentialisiert und dichotomosiert, d. h. sie werden als im Wesentlichen untereinander gleich angenommen (Homogenisierung), weil ihre Gene, Kultur oder Religion so sei (Essentialisierung) und sie darin ganz anders als wir seien (Dichotomisierung). Differenzen innerhalb der in diesem Otheringprozess hervorgebrachten Gruppen werden vernachlässigt oder zu Ausnahmen erklärt – ebenso wie Gemeinsamkeiten über die Gruppengrenzen hinweg. So werden etwa (prominent im Falle des antimuslimischen Rassismus) Sexismus, Homophobie oder Antisemitismus im ‚eigenen‘ Kontext entweder als berechtigt oder als Ausnahme bzw. Relikt aus der Vergangenheit verharmlost, während sie bei ‚den anderen‘ zu einem genuinen Merkmal ihrer ‚Rasse‘, Ethnie, Kultur oder Religion erklärt und problematisiert werden. Gleichzeitig werden homosexuelle und feministische Muslim_innen ebenso ausgeblendet wie muslimisch-jüdische Initiativen sowie Positionen und Aktivitäten von Muslim_innen gegen Sexismus, Homophobie oder Antisemitismus. Mit dieser klaren Trennung von ‚uns‘ und ‚den anderen‘ sind spezifische Funktionen verbunden: Rassismus legitimiert die Regulierung von Teilhabe und Zugehörigkeit. Rassismus dient dazu, „Gruppen vom Zugang zu materiellen und kulturellen Gütern auszuschließen […] sie symbolisch aus der Familie der Nation auszuweisen“ (Hall 2016: 183). Mit Hinweis auf ihre Nicht-Zugehörigkeit bzw. Zugehörigkeit wird begründet, warum einigen mehr Rechte und privilegierter Zugang zu Ressourcen zusteht als anderen. Die Zuweisung gesellschaftlich unerwünschter Äußerungen und Handlungen an ‚die anderen‘ dient der Konstruktion ‚des Eigenen‘. Die nationale Identität wird über Ab- und Eingrenzung, Nicht-Zugehörigkeit bzw. Zugehörigkeit definiert und in Repräsentationsverhältnissen und institutioneller Diskriminierung festgeschrieben.

Repräsentationsverhältnisse stellen jene kulturellen Bedeutungsträger dar, mit denen wir täglich konfrontiert sind und die uns Normalität vermitteln, ohne dass wir uns i. d. R. damit bewusst und gezielt auseinandersetzen. Wenn etwa staatliche oder öffentliche Funktionsträger_innen allesamt weiß sind, wenn in Bildungsmaterialien und Medienberichterstattung, im Straßenbild (Namen von Straßen, Plätzen, Gebäuden) und in der Werbung ausschließlich weiße Personen vorkommen und Schwarze nur dann dargestellt werden, wenn es um Probleme oder um ihr Schwarzsein geht, dann vermittelt sich den Bürger_innen ganz selbstverständlich und ohne eigenes Zutun der Eindruck, dass Weißsein normal und Schwarzsein zumindest erklärungsbedürftig, meist auch problematisch ist. Es verwundert dann nicht, wenn Schwarze misstrauisch beäugt werden, ihr Dasein als befristet oder illegal wahrgenommen wird und sie als Ausländer_innen angesprochen werden.
Institutionelle Diskriminierung wiederum meint, dass alltägliche Routinen und Regelungen, Normen und Verhaltensweisen bestimmte Gruppen regelmäßig bevorzugen und andere benachteiligen. Es ist der Effekt, der Auskunft darüber gibt, ob institutionelle Diskriminierung vorliegt oder nicht. Das unterscheidet die Diskriminierung vom Vorurteil, denn es geht nicht nur um Einstellungen, Äußerungen und Handlungen Einzelner, „sondern auch [um] gesellschaftsstrukturelle (ökonomische, politische, rechtliche), kulturelle (Diskurse und Ideologien), institutionelle sowie organisatorische Bedingungen und Formen von Diskriminierung“ (Hormel/Scherr 2010: 11). Erst im Zusammenspiel mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen wird also aus unhöflichem Verhalten und alltäglicher Ungleichbehandlung eine Diskriminierung. Diskriminierung kann verschiedene Gruppen betreffen. Im Grundgesetz (GG) und im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) sind jene Gruppen aufgeführt, die in der Bundesrepublik vor Diskriminierung zu schützen sind, weil ihnen als Mitglieder einer dieser Gruppen aufgrund historischer Entwicklungen und gesellschaftlicher Verhältnisse Unrecht zugefügt wurde und ihre Entfaltungs- und Handlungsmöglichkeiten zu Unrecht begrenzt wurden. Konkret heißt es im AGG § 1:
Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. (AGG § 1)
Im AGG § 4 wird darüber hinaus die Mehrfachdiskriminierung berücksichtigt, die in wissenschaftlichen Debatten als Intersektionalität oder Interdependenz thematisiert wird. Demnach werden etwa Kopftuch tragende Frauen aufgrund ihres Geschlechts und ihrer Religion (und eventuell ihrer ‚ethnischen Herkunft‘ oder ihrer ‚Rasse‘) diskriminiert oder transsexuelle Schwarze Personen wegen ihrer ‚Rasse‘ und ihrer ’sexuellen Identität‘. Im Unterschied zu den Begriffen in den Gesetzestexten wird aber in wissenschaftlichen Studien der ‚Rasse’begriff nicht verwendet (bzw. als soziale Konstruktion in kritischer Rassismusforschung berücksichtigt), weil es keine menschlichen ‚Rassen‘ gibt. Wenn also der Fokus in Studien und Aktionsprogrammen (s. Enquetekommission des Thüringer Landtags) auf Rassismus und Diskriminierung gelegt wird, dann geht es zwar hauptsächlich um Rassismus, aber es wird ein besonderes Augenmerk gelegt auf „gesellschaftsstrukturelle (ökonomische, politische, rechtliche), kulturelle (Diskurse und Ideologien), institutionelle sowie organisatorische Bedingungen und Formen“ (Hormel/Scherr 2010: 11) sowie auf die Intersektionalität von Rassismus mit anderen Formen gesellschaftlicher Machtverhältnisse, also von Rassismus im Zusammenhang mit Geschlecht, Sexualität, Klasse, Behinderung und Alter.
In der Rassismusforschung werden zwei Varianten des institutionellen Rassismus unterschieden.
Beide vermeiden offen rassistische Argumentationen, sodass Rassismus in der aktuellen Äußerung nicht explizit genannt wird, aber dennoch darin enthalten ist.

In der ersten Variante bezieht sich institutioneller Rassismus „auf Verhältnisse, in denen Ausgrenzungspraktiken aus einem rassistischen Diskurs entstehen, den sie folglich verkörpern, ohne dass sie weiterhin durch ihn gerechtfertigt werden könnten“ (Miles 1991: 113). Ein Beispiel: Kopftuch tragende Musliminnen klagten gegen ihre Diskriminierung bei der Vergabe von Arbeitsstellen im öffentlichen Dienst. Die Verfassungsbeschwerde der Lehrerin Fereshta Ludin erregte breite öffentliche Aufmerksamkeit. Das Urteil im Jahr 2003 stellte fest, dass es keine gesetzliche Grundlage für den Ausschluss vom Schuldienst aufgrund ihres Kopftuches gebe.
Daraufhin wurde in einigen Bundesländern eine Regelung verabschiedet, die es Lehrerinnen verwehren sollte, mit Kopftuch zu unterrichten. Sie wurde mit dem staatlichen Neutralitätsgebot begründet, und zwar auch in Bundesländern, die bis dahin kein Problem damit hatten, religiöse Symbole anderer Religionsgemeinschaften zu respektieren (in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen wurden etwa christliche Symbole von der Regelung ausdrücklich ausgenommen). Kopftuch tragende Frauen wurden also weiterhin nicht im öffentlichen Dienst eingestellt, allerdings nun mit Hinweis auf das Neutralitätsgesetz. Die Rechtfertigung hat sich verändert, die Ausgrenzungspraxis ist geblieben. Inzwischen mussten allerdings einige Bundesländer entsprechende Entscheidungen revidieren, da nach weiteren Klagen deutlich wurde, dass Muslim_innen auch durch das Neutralitätsgesetz diskriminiert werden (Baer/Wiese 2008).
In der zweiten Variante bezieht sich institutioneller Rassismus „auf Verhältnisse, in denen ein explizit rassistischer Diskurs dergestalt abgewandelt wird, dass der direkt rassistische Inhalt verschwindet, während die ursprüngliche Bedeutung sich auf andere Wörter überträgt“ (Miles 1991: 113). Im Deutschen etwa findet der Begriff ‚Rasse‘ auf Menschen bezogen kaum noch Anwendung, er ist aber durch den Begriff der ‚Ethnie‘ oder der ‚Kultur‘ ersetzt worden, sodass nun Sinte_zza und Rom_nja nicht mehr wegen ihrer vermeintlichen ‚Rasse‘, sondern ihrer vermeintlichen ethnischen oder kulturellen Eigenheiten diskriminiert werden.
Institutioneller Rassismus muss also nicht als solcher offen ausgesprochen werden, er muss auch nicht intendiert sein, ja er muss noch nicht einmal durch Handlungen erfolgen, sondern auch durch Unterlassung – etwa indem kein Unterschied gemacht wird, obwohl dadurch gesellschaftliche Benachteiligung ausgeglichen werden könnte. Dafür hat sich der Begriff der indirekten Diskriminierung etabliert:
Unter indirekter Diskriminierung verstehen wir gleiche Behandlung unter gleichen Umständen aber bei ungleichen sozialen Bedingungen. Indirekte rassistische Diskriminierung ist der Ausdruck einer wissentlichen oder unwissentlichen Vernachlässigung der spezifischen Bedingungen, die die soziale Realität der Schwarzen und immigrierten Menschen bestimmen. (Essed 1991: 22)
Die indirekte Diskriminierung wird im AGG § 3 (2) wie folgt berücksichtigt:
Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen wegen eines in § 1 genannten Grundes gegenüber anderen Personen in besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich. (AGG § 3 [2])
Im Gegensatz zum Begriff des Rassismus, der die Markierung und Ungleichbehandlung von Menschen entlang essentialistischer Zuschreibungen im Zusammenhang mit Hautfarbe, Herkunft, Kultur und/oder Religion beschreibt, umfasst der Begriff der Diskriminierung ein größeres Spektrum gesellschaftlicher Ungleichbehandlung. Dazu zählt etwa die Diskriminierung von Menschen aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter und/oder Behinderung. Sexismus, Ableismus sowie Homo- und Transphobie sind jeweils spezifische Diskriminierungsformen, die entsprechende Merkmalsträger_innen abwerten und hierarchisch unterordnen. Rassismen sind auf der allgemeinen Ebene mit anderen Otheringprozessen und gesellschaftlichen Machtverhältnissen vergleichbar. Diese sind miteinander verschränkt (Intersektionalität). Rassismen werden je nach historischem und gesellschaftlichem Kontext deutlicher biologisch, genetisch, kulturell oder religiös begründet. Zwar ist beispielsweise die offene Zustimmung zu Antisemitismus in der breiten Bevölkerung weiter rückläufig (6 % Zustimmung zu klassischem Antisemitismus, 26 % zu sekundärem Antisemitismus), jedoch finden antisemitische Motive ein Ventil in sogenannter ‚Israelkritik‘ (40 % Zustimmung zu israelbezogenem Antisemitismus; UEA 2017). Vergleichsweise artikulieren sich Narrative eines antimuslimischen Rassismus in einer sogenannten ‚Islamkritik‘. Ausgangspunkt bildet die Zuschreibung kollektiver Merkmale, die zum Wesen des Islams und der vermeintlichen Religionsangehörigen erklärt werden. Die Homogenisierung dient dazu, einerseits Differenz zu ‚uns‘ zu behaupten, andererseits den Ausschluss muslimisch markierter Menschen aus der Gesellschaft zu begründen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn Menschen aufgrund ihres Aussehens, Namens oder ihrer (vermeintlichen) Herkunft als Muslim_innen kategorisiert werden und ihnen daraufhin Illoyalität oder eine fehlende Integrationsbereitschaft unterstellt wird. Verschwörungstheorien einer ‚Islamisierung‘ Deutschlands oder der Vorwurf einer ‚Unterwanderung‘ und ‚Überfremdung‘ der Gesellschaft konstruieren dementsprechend ‚den Muslim‘ zum Gegenbild ‚des Deutschen‘, verweigern ‚den anderen‘ Teilhabe und verteidigen ‚eigene‘ Privilegien. In diesem Sinne werden Spielarten des Antisemitismus und Rassismus mit Verweis auf die demokratische Meinungsfreiheit als gesellschaftliches Recht eingefordert, und zwar unter Missachtung der Rechte Anderer.
AutorInnen:
Dr.Iman Attia
ist Professorin an der Alice Salomon Hochschule Berlin, wo sie im Arbeitsbereich Rassismus und Migration forscht und lehrt. Demnächst erscheint von ihr und Mariam Popal der Sammelband: Grenzziehungen aufspüren und verwischen beim Unrast-Verlag.
Ozan Zakariya Keskinkılıç
studierte Internationale Entwicklung und Internationale Beziehungen in Wien und Berlin. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in Forschung und Lehre an der Alice Salomon Hochschule Berlin im Arbeitsbereich Rassismus und Migration. Zusammen haben Iman Attia und Ozan Zakariya Keskinkılıç den Beitrag Antimuslimischer Rassismus im Handbuch Migrationspädagogik (2017 von Paul Mecheril herausgegeben) verfasst.
Die Erstveröffentlichung auf: www.idz-jena.de/wsddet/wsd2-11 entstand aus einer Stellungnahme für die Enquetekommission des Thüringer Landtags „Ursachen und Formen von Rassismus und Diskriminierung in Thüringen sowie ihre Auswirkungen auf das gesellschaftliche Zusammenleben und die freiheitliche Demokratie“. Die Autorin ist Mitglied der Enquetekommission.