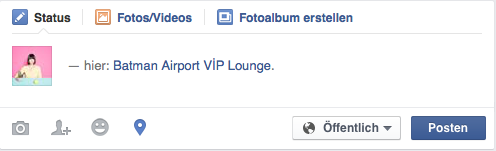Kostenlose Bildungsarbeit gegen Rassismus, Sexismus und Ausbeutung – da denken die meisten an Tweets, Newsletter, vielleicht Podcasts. Aber es gibt auch Menschen, die sich auf direktem Weg in die politische Bildung einbringen. Ohne Entlohnung. Wofür dann? Unsere Autorin hat drei ehrenamtliche Bildungsarbeiter*innen getroffen.
Zwei Stunden, bevor wir uns treffen, warnt Jakob mich vor. Er wird für unser Interview weniger Zeit haben als gedacht. Im Anne-Frank-Zentrum, wo er seit acht Jahren als Ausstellungsbegleiter arbeitet, wird spontan jemand gebraucht. Klar, dass er einspringt. Der 27-Jährige begleitet Schulgruppen durch die Bildungsstätte am Berliner Hackeschen Markt. Es geht um Leben und Werk Anne Franks, um Antisemitismus damals und heute. Um Erinnerungskultur und die Rassismen der deutschen Gesellschaft.
Geschichte erklären, um sie selbst zu verstehen
Dabei war ihm am Anfang selbst kaum bewusst, wie eng das alles zusammenhängt. „Die historisch-politischen Zusammenhänge habe ich erst im Laufe der Zeit begriffen, mit meiner eigenen Politisierung. Durch die Vermittlung der Geschichte habe ich ja selbst wahnsinnig viel gelernt“ erzählt er. Sein Rollenbild sei heute ein anderes als vor acht Jahren. „Damals war ich strenger mit den Gruppen und habe schneller Grenzen gesetzt. Irgendwann verstand ich, dass die Leute eine Fläche brauchen, um ihre eigenen Zugänge zur Thematik zu finden. Dafür sind wir da. Und wenn ein Jugendlicher Sachen sagt, die inakzeptabel sind, hat das oft einen ganz bestimmten Grund.“
Zugänge zu sensiblen Themen eröffnen, Bedürfnisse erkennen, Grenzen aushandeln – es ist Millimeterarbeit. „Eine echt schwierige Situation hatte ich einmal mit einer achten Klasse aus Ostdeutschland, in der mehrere das Bedürfnis hatten, Neonazis in Schutz zu nehmen. Plötzlich wurde der Vergleich zu Muslimen gezogen – Nazis und Muslime als gleichrangige gesellschaftliche Antagonisten. Da habe ich gemerkt: für diese Leute ist die Naziszene ein Identifikationsangebot, und zwar das, das ihnen im Moment die meiste Sicherheit spendet. Der klassisch jugendliche Wunsch nach Identität eben, nach Zusammenhalt und Bestätigung, und natürlich spielt auch der bewusste Tabubruch eine Rolle.“
Was er gemacht habe? Natürlich eine Grenze gezogen, aber eben auch erklärt. Dass sie das, was sie bei Neonazis suchen, auch woanders finden können, „und zwar so, dass dabei keine Menschen sterben“. In jeder anderen Rolle, sagt Jakob, hätte er das Gespräch abgebrochen.

Anne Frank Zentrum, Foto: Mandy Klötzer
Was uns Erinnerung wert ist
Über die Frage, was an der Arbeit schwerfällt, unterhalten wir uns lange. Manchmal müsse er die eigenen politischen Vorstellungen zurückstellen, sagt Jakob. Die strukturelle und ökonomische Dimension von Rassismus sei für die Schüler*innen häufig zu abstrakt.
Eine weitere Hürde, an die er sofort denken muss, ist das Geld. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich es noch nicht, aber ich werde das, was er gleich sagt, in jedem einzelnen Interview hören. „Der ganze Bereich ist abhängig von Fördergeldern. Das heißt, dass das Geld eigentlich immer knapp ist, unsere Aufwandsentschädigungen gering sind und bei den Hauptamtlichen nur wenige entfristet werden können.“ Und dann wird es – wenig überraschend – nochmal politisch. „Die Politik betont immer wieder, wie wichtig unsere Arbeit ist. Und das stimmt auch. Ich glaube, wir leisten einen wirklich wichtigen Verdienst für die Demokratie und zur Prävention von Rechtsextremismus. Aber das spiegelt sich überhaupt nicht in der Sicherheit der Förderung wider.“ Stattdessen würden antifaschistische Organisationen selbst mit Extremismusvorwürfen konfrontiert. Ich muss an die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes denken, die vor zwei Jahren ihre Gemeinnützigkeit verlor, weil der bayerische Verfassungsschutz sie als linksextrem einstuft.
Ganz im Sinne des historisch-politischen Zusammenspiels hat Jakob auf die Frage, warum er es macht, zwei Antworten. „Einerseits ganz einfach deshalb, weil ich eine Gesellschaft will, in der es anderen nicht schlechter geht, damit es mir gut geht. Und auf der historischen Ebene glaube ich, dass der Nationalsozialismus unsere Gesellschaft ganz entscheidend geprägt hat. Zu dieser Geschichte kann man sich kein distanziertes Verhältnis erlauben.“
Kunst gegen das Vergessen
Hojin, 36, Künstler und Grafikdesigner, hat sich gleich eine ganz neue Form der Gedenkarbeit ausgedacht: ein virtuelles Denkmal, das per QR-Code oder URL an jeden beliebigen Ort platziert werden kann. Angefangen hat alles mit einem Zufall.
In den Räumen des Korea Verbands in Berlin gibt es eine Ladenfläche, die gleichzeitig als Ausstellung und Shop für Besucher*innen dient. Im Mai 2020 kommt Hojin bei einem Besuch des Ladens mit der Vorstandsvorsitzenden Nataly Han ins Gespräch. Sie erzählt, der Korea Verband plane ein Museum über die sogenannten Trostfrauen, die im Zweiten Weltkrieg von der japanischen Regierung in die Prostitution gezwungen wurden. Die Geschichte ist hierzulande wenig bekannt. Bis zu 200.000 Opfer könnten es gewesen sein, die genaue Zahl weiß niemand. Die Frauen kamen überwiegend aus Japan, Korea und Taiwan, teilweise aus China, Indonesien, Malaysia. 70 Prozent von ihnen überlebten die Zwangsprostitution in den Kriegsbordellen, die mit Hunger, Krankheiten und extremer Gewalt einherging, nicht.
Diesen Frauen wolle der Verband ein Denkmal setzen, erzählt die Vorstandsvorsitzende. Hojin beschließt, mitzumachen. Ehrenamtliches Engagement ist für ihn nichts neues. Er hat einiges ausprobiert, Film- und Spieleabende in einem Obdachlosenheim organisiert, einen Kampfsportkurs in einer Geflüchtetenunterkunft gegeben. Rückblickend glaubt er, sich damals überschätzt zu haben. Er habe die Grenzen seiner eigenen Fähigkeiten nicht erkannt, sagt er heute, sei manchmal nicht genug auf tatsächliche Bedürfnisse vor Ort eingegangen.
Bei seiner Arbeit im Koreaverband ist das anders. Im September 2020 wird in Berlin-Moabit eine Bronzeskulptur eingeweiht. Eine sitzende Frau in traditioneller koreanischer Kleidung, neben ihr ein leerer Stuhl. Der Verband nennt sie die Friedensstatue, Spitzname Ari, armenisch für „die Mutige“.
„Die Einweihung war ein Riesenevent“, erzählt Hojin. Im Zuge dieses Events erstarkt die Bewegung, die an die Trostfrauen erinnert – aber auch der Widerstand derer, denen die Erinnerung ein Dorn im Auge ist.
Kampf um die Friedensstatue – im Senat, vor Gericht und schließlich im Netz
Direkt nach der Einweihung geht von der japanischen Botschaft eine Anfrage beim Berliner Senat zur Entfernung der Statue ein. Und die zuständige Behörde gibt klein bei. Von „erheblichen Belastungen des deutsch-japanischen Verhältnisses“ ist in der Abrissverfügung die Rede. Der Koreaverband zieht vor Gericht. „Schlussendlich konnte der Verband den Verbleib durchsetzen“, sagt Hojin. „Die Statue darf erst entfernt werden, wenn uns ein geeigneter Alternativplatz zugewiesen wird.“ Sie steht heute noch an Ort und Stelle, Birkenstraße Ecke Bremer Straße.
Aber für Hojin hat sich etwas verändert. „Ich war so pissed, dass der Senat da eingeknickt ist“ sagt er, und die Wut ist noch immer spürbar. „Natürlich einerseits als Koreaner, aber auch im Namen der Meinungsfreiheit, im Namen der Kunstfreiheit.“ Er will handeln. Und nutzt das, was ihm am meisten liegt: die Kunst.
„Ich habe mich gefragt: wie kriegst du es hin, dass in der ganzen Welt virtuelle Friedensstatuen hingestellt werden können – egal, wer etwas dagegen hat?“ Hojin schart ein Team um sich, Programmierer*innen, Designer*innen, 3D-Modelleur*innen. Es ist ein Haufen Arbeit. Nach über einem halben Jahr ist WEB ARi, wie sie sie nennen, endlich fertig.

Hojin Kang, Korea Verband
Nach dem Launch im August 2021 geht das Projekt in der deutsch-koreanischen Community viral und wird auch von koreanischen Medien aufgegriffen. In kürzester Zeit erreichen den Verband über 100 Einsendungen aus zwölf Ländern, die auf der Website veröffentlicht sind: Ari am Schiefen Turm von Pisa an der New Yorker Brooklyn Bridge, am Strand von Bodrum, an einer belebten Straßenecke in Tokio.
„Wir haben ein wahnsinnig positives Feedback bekommen, viel mehr, als ich je erwartet hätte“, erzählt Hojin. Und noch etwas ist anders als gewohnt.
„Unfassbar viele Leute haben sich bei uns bedankt. Ich habe in meinem Hauptberuf als Grafikdesigner und Art Director in Agenturen seit so vielen Jahren mit Kund*innen zu tun, an deren Aufträgen ich Tag und Nacht arbeite, damit sie perfekt werden. Da habe ich noch nie ein ernsthaftes ‚Danke‘ bekommen.“
Arbeitskampf 101
Arbeit steht bei Pauline im Mittelpunkt. Sie ist 26, gelernte Kinderkrankenpflegerin und war schon während ihrer Ausbildung aktives Mitglied der Gewerkschaft ver.di. Heute engagiert sie sich dort neben ihrem Studium ehrenamtlich für die tarifpolitische Weiterentwicklung und macht junge Menschen aus den verschiedensten Branchen fit für den Arbeitskampf. In Seminaren vermittelt sie Azubis, die in ihren Betrieben als Vertreter*innen gewählt wurden, das Einmaleins der gewerkschaftlichen Interessenvertretung – von juristischen Grundlagen über Tarifgespräche bis zum Umgang mit Diskriminierung im Betrieb. Ebenso gehören externe Gewerkschaftsworkshops zu ihrer Arbeit, etwa in Jugendorganisationen.
„Mir ist wichtig, den Seminarteilnehmenden das gewerkschaftliche Selbstverständnis zu vermitteln: wir sind eine Kollektivvertretung, wir haben gemeinsame Interessen, die wir gegen den Arbeitgeber durchsetzen.“ Dabei geht es auch mal ans Eingemachte. „Natürlich geht das nicht ohne ein gutes Verständnis für gesellschaftliche Reichtumsverteilung. Oder für die Produktionsabläufe, deren Teil die Azubis ja sind. Es geht um ein materialistisches Verständnis, auch in unseren Antirassismusseminaren.“
Kollektiv lernen, kollektiv kämpfen
Ohne zu zögern, antwortet Pauline auf die Frage, was an der Arbeit schwerfällt: „Es sind total prekäre Verhältnisse. Man bekommt für die Seminare selbst zwar eine kleine Aufwandsentschädigung. Aber die ganze Konzeptarbeit, die methodischen Schulungen, das Erlernen und Weiterentwickeln der Seminarinhalte, ist komplett unbezahlt.“
Und dann ist da, wie bei Jakob, die Aushandlung von Grenzen. „Anfang 2015 habe ich auf jeden Fall den erstarkenden Rassismus auch in meinen Seminaren gespürt. Damit musste ich dann einen Umgang finden – es ist eine Gratwanderung. Denn wir arbeiten ja nach dem Prinzip der Bildungsarbeit ohne Hierarchie, ohne dieses Lehrerverhältnis.“
Warum sie es trotzdem macht? „Weil ich glaube, dass kollektives Lernen ein zentraler Schritt hin zu einer emanzipatorischen Gesellschaft ist. Es ist eine ganz besondere Erfahrung, einen wertschätzenden Raum zu schaffen, in dem man sich ausprobiert und die Teilnehmenden sich ausprobieren lässt – aber auch inhaltlichen Input und Widerspruch gibt und erhält.“
Dazu passt auch ein Moment, der ihr besonders im Gedächtnis geblieben ist. „Nach einem Tarifseminar hat ein Teilnehmer auf einen Feedbackbogen geschrieben: ‚Die richtige Umgebung macht gutes Lernen‘. Nachdem wir vorher unter anderem Marx‘ Arbeitswertlehre gepaukt hatten. Das hat für mich perfekt zusammengefasst, wofür ich es mache.“
Die drei arbeiten in völlig verschiedenen Bereichen. Ihre Beweggründe unterscheiden sich grundlegend. Nur eine Frage beantworten alle gleich, die nach der größten Hürde bei ihrer Arbeit. In der politischen Bildung ist an allen Ecken und Enden das Geld knapp. Dabei haben sie noch etwas gemeinsam: ohne ihre Arbeit sähe es finster aus in Deutschland. Aber entsprechend etwas kosten lassen will sich der Staat das nicht.
Text: Özge Inan