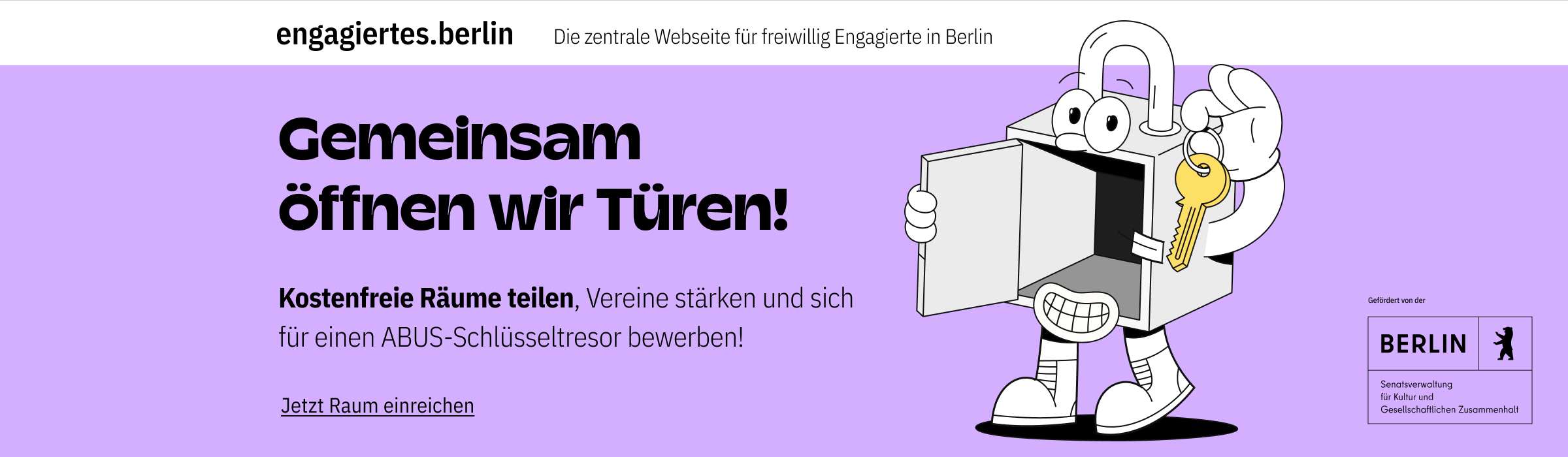Deutsch reden, deutsch denken, deutsche Lieder singen, kochen, essen, bezahlen – im „Integriertsein“ bin ich richtig gut. Aber was ist, wenn man irgendwann gar nicht mehr so recht weiß, wer oder was man eigentlich ist, weil man doch vorher etwas anderes war? Eine Spurensuche.
Früher hab ich mir einen Spaß draus gemacht, wenn ich beim Dönerbestellen nicht auf Türkisch angesprochen wurde. Es amüsierte mich nicht nur, ich war zugleich froh und ein bisschen stolz darauf, wenn meine deutsche Tarnung hielt. An meiner Aussprache konnte man es nicht heraushören und es stand mir auch nicht auf der Stirn geschrieben, dass zu Hause hauptsächlich Türkisch gesprochen wurde. Deshalb fühlte ich mich manchmal wie ein Doppelagent, der für zwei Seiten arbeitet; für die deutsche und die türkische. Ich genoss es, ein unauffällig anpassungsfähiges Chamäleon zu sein, etwas privilegiert gegenüber jenen, die ohne Nachdruck in eine Schublade passten.
Anne
Einige meiner Landsleute – oder genauer gesagt: die meiner Eltern – haben es mir oft übel genommen, wenn ich mit Deutschen befreundet war, oder mit ihnen auf dem Schulhof abhing. Für manch einen war ich dann ein Überläufer, Verräter und was weiß ich, was noch alles … fahnenflüchtiger Nestbeschmutzer. An mir lief das jedoch runter wie Fett am Dönerspieß.
Die Weichen für diese Entwicklung legte wahrscheinlich anne, meine Mutter, als sie sich bereits 1982 mit aller Kraft dagegen wehrte, ihr sechsjähriges Nesthäkchen in eine Grundschulklasse mit 100%igem Ausländeranteil zu stecken. Sie musste keine Hellseherin sein, um sich auszumalen, was aus mir unter meinesgleichen werden würde. Ich spreche von der Zeit, als man sich an der ein oder anderen öffentlichen Schule ernsthaft fragte, ob es nicht sinnvoller wäre, die sogenannten ausländischen Kinder über einen separaten Eingang ins Gebäude zu schleusen. Der Zeit, als die Gastgeber – oder genauer gesagt Anwerber – davon ausgingen, dass die Gastarbeiter nach verrichteten Dingen ihre Siebensachen packen und wieder nach Hause fahren würden. Am besten genauso sang- und klanglos wie sie gekommen waren. Schnell mal eben das verwüstete Nachkriegsdeutschland mit aufbauen und dann schön zurück nach Anatolien. So nach dem Motto „Hadi, tschüss, bitte geht jetzt wieder dahin zurück, wo der Pfeffer wächst!“ Wie die Geschichte weiterging, ist allgemein bekannt.

Bronxloh
Die Ottostrasse, die wir in Bronxloh, besser bekannt als Duisburg-Marxloh, bewohnten, war als eine Art Grenze zu verstehen: Auf der einen Seite lebten „die Deutschen“, auf der anderen vor allem Türkischstämmige, gefolgt von sogenannten Jugos und Arabern.
Der Zufall wollte es so, dass wir direkt an dieser unsichtbaren Trennlinie wohnten, so gerade noch auf „deutscher“ Seite. Sicherlich hat es meine Alemanophilie begünstigt, dass wir uns in Gesellschaft sehr netter deutscher Nachbarn befanden, die dort teilweise in mehreren Generationen wohnten und uns so akzeptierten, wie wir waren: ein wenig exotisch eben.
So kam es, dass meine engsten Freunde hauptsächlich Deutsche, Polen oder „höchstens“ Jugos waren. Das hielt sich bis zu meiner Pubertät so. Irgendwie hatte ich einen Eifer entwickelt, das Vertraute zu vernachlässigen, um das Neue zu verinnerlichen. Ich war neugierig drauf, und das Türkische hatte sich ausschließlich auf Urlaubsaufenthalte in der Türkei und das Familienleben in den eigenen vier Wänden konzentriert. Draußen wollte ich nicht türktümeln.
Comeback
Mein Comeback ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Mit fünfzehn etwa fühlte ich, wie der Türke in mir noch schlummerte, ungestüm und wütend. Außerdem hatte ich ältere Geschwister, die mich regelmäßig daran erinnerten, ob sie es wollten oder nicht. Und so sehr es mir gelang, akzentfrei Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung zu sagen; am Ende des Tages blieb eine Leere in mir zurück, die mich nie vergessen ließ, wer wir wirklich waren: Türkischstämmige mit mazedonisch-, albanisch-, griechischem Migrationshintergrund. Das muss man sich erst mal auf der Zunge zergehen lassen!
Diese undefinierte Lücke füllte sich dann unter Türkischstämmigen, wo ich mich verstanden und aufgehoben fühlte wie schon lange nicht mehr. Ich fing an, vermehrt ihre Nähe zu suchen, wieder und wieder, immer für kurze Zeit. So entwickelten sich zwei Persönlichkeiten in mir; unter Türken zahlte ich für alle, unter Deutschen nur die eigene Pommes. Bis sich irgendwann einige deutsche Kumpels türkische Sitten zu eigen machten und mich schräg ansahen, wenn ich nur für mich zahlen wollte. Ein erschütternder Vorwurf lag in der Luft: „Ey, wat bis’ du denn für ’n Türke?“
Ich
Dann wurd’s richtig kompliziert. Wie ein Pendel schlug ich plötzlich zwischen zwei Kulturen, ja Welten. Der Druck, sich irgendwann entscheiden zu müssen, wurde immer stärker, von Schwindelgefühlen ganz zu Schweigen. Im Anblick eines aufgewachten interkulturellen Dämons fragte ich mich: Wer bin ich?
Es dauerte einige Zeit, bis ich kapierte: Ich brauche mich nicht zu entscheiden. Ich kann so deutsch sein wie ich will und mich dabei gleichzeitig sehr kurdisch, chinesisch, polnisch, bosnisch, kroatisch, serbisch, italienisch, arabisch – oder eben türkisch fühlen. Es ist ein Reichtum. Von ihm kann man allerdings erst dann nachhaltig profitieren, wenn man loyal gegenüber allen Seiten ist. Sicher, das mag schizophren klingen. Doch ich glaube, dass es nicht nur mir, sondern einem jeden von uns langfristig inneren Frieden verschaffen kann.
Inşallah! (dt.: So Gott will)
Text: Atilla Oener
Hier geht es zur ersten Kolumne von Atilla – Süpermann mit Charme und Schürze